Lehrveranstaltungen zum Thema „Exil“
Die nach Semester geordnete Übersicht enthält die Lehrveranstaltungen (inklusive Kommentar), die von dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Forschungsstelle im Rahmen des Lehrveranstaltungsangebots am Institut für Germanistik zum Thema „Exil“ angeboten wurden.
Die Seminare werden teilweise in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen am Institut oder aus anderen Fächern durchgeführt.
Sommersemester 2024
Finja Zemke: Exilliteratur in der Vergangenheit und Gegenwart (IntLit) Internationales Seminar an der Universität Hamburg und der Sofia University St. Kliment Ohridski im Rahmen der Institutspartnerschaft und der DAAD-Ostpartnerschaften
In diesem Seminar wollen wir literarische Texte aus verschiedenen historischen Zeiten in den Blick nehmen, die vom Exil erzählen. In der gegenwärtigen Zeit, in der durch Globalisierung und Kriege, zunehmend Migrationsbewegungen stattfinden, kommt der Auseinandersetzung mit Exilgeschichte(n) im öffentlichen Diskurs eine besondere Bedeutung zu. Mit Blick auf literarische Texte und Medien von der Antike bis zur Gegenwart wollen wir im Seminar der Frage nachgehen, was unter Exilliteratur im historischen und medialen Wandel zu verstehen ist und was das für den gegenwärtigen Umgang mit Geschichten von Migration, Flucht und Exil bedeutet. Dafür untersuchen wir die jeweiligen Exilgeschichten in ihrer Singularität, beleuchten aber auch den größeren Zusammenhang des Exils als menschliches Phänomen. Dabei spielt auch die Frage nach intertextuellen Referenzen in den literarischen Texten eine Rolle, insofern sich beobachten lässt, dass sich im Exil viele Schriftsteller:innen in ihren Texten auf Texte anderer Schriftsteller:innen beziehen, die selbst auch im Exil waren – aber in einer anderen Zeit und damit unter anderen Bedingungen.
Seminarlektüre (Auswahl): Ovid „Tristia“, Heinrich Heine „Deutschland. Ein Wintermärchen“, ausgewählte Gedichte von Mascha Kaléko, „Kind aller Länder“ von Irmgard Keun (und Theateradaption von 2023), ausgewählte Collagen von Herta Müller, „Der Hof im Spiegel“ von Emine Sevgi Özdamar, Verfilmung/Theateradaption von Anna Seghers Roman „Transit“, „Deutsch für alle. Das endgültige Lehrbuch“ von Abbas Khider
Das Seminar wird im Sommersemester auch an der Sofia University St. Kliment Ohridski in Bulgarien angeboten. Um Sie mit den Studierenden dort zu vernetzen und Ihnen ein internationales Lernsetting zu ermöglichen, findet das Seminar in einer Mischung aus Präsenz- und Online-Lernformen statt.
Bei Interesse und einer (anteiligen) Förderung ist in der Pfingstferienwoche im Mai eine gemeinsame Exkursion nach Sofia geplant.
Details zur (inhaltlichen) Seminargestaltung werden in der ersten Sitzung gemeinsam besprochen.
Wintersemester 2023/2024
Doerte Bischoff: Deutsch-jüdische Literatur (Konzepte, Traditionen, Genres) Vorlesung
In ihren Poetik-Vorlesungen über „Schreiben, Schriftsteller und Judentum" (2006) umreißt Barbara Honigmann das Feld deutsch-jüdischer Literatur, das sie von zwei schreibenden Frauen begrenzt sieht: Glückel von Hameln, die als Geschäftsfrau in Hamburg lebte und um 1700 ihre Autobiografie auf Jiddisch verfasste, und Anne Frank, deren Familie während der NS-Zeit aus Frankfurt nach Amsterdam zog, von wo sie später deportiert wurde. Wie Glückel schrieb Anne Frank ihr Tagebuch im Hinterhaus nicht auf Deutsch, sondern verwendete die Sprache ihres Exil- und Asyllandes, Niederländisch. Diese Rahmung deutsch-jüdischer Literatur ist ungewöhnlich und provokativ: in den meisten Darstellungen in Lexika und Handbüchern beginnt diese erst im späten 18. Jahrhundert mit der jüdischen Aufklärung und den ersten Publikationen von Gedichten und Erzählungen, die Juden und Jüdinnen in deutscher Sprache verfassten. Ob deutsch-jüdische Literatur mit dem Holocaust, deren Opfer auch Anne Frank wurde, ein endgültiges Ende gefunden hat, ist Gegenstand einer andauernden Diskussion. Selbst wo argumentiert wird, dass es nach 1945 trotz allem Deutsch schreibende jüdische Autor:innen gegeben hat, nicht zuletzt als wichtige Stimmen einer literarischen Erinnerung an die Shoah, und dass durch Migration spätestens seit der Wende zahlreiche Texte entstanden sind, die über jüdische Identität und transnationale Familiengeschichten in deutscher Sprache reflektieren, wird jedoch die Verknüpfung von deutsch und jüdisch durch einen Bindestrich überwiegend problematisiert. Zu sehr erinnert diese an den Traum von einer „deutsch-jüdischen Symbiose" (Scholem) und ihr dramatisches Scheitern. In der programmatischen Aufforderung „Desintegriert Euch!" (Czollek) klingt aber nicht nur eine Absage an eine Tradition der Assimilation an, sie ist auch als selbstbewusste Behauptung eines jüdischen Beitrags zur Gegenwartsliteratur und -kultur in Deutschland zu verstehen. Eine wichtige Protagonistin ist weiterhin Barbara Honigmann, die, selbst in Straßburg lebend, Ränder und Randexistenzen zum Ausgangspunkt ihres Schreibens macht und gerade darin tradierte Konzepte von Nationalliteratur, Zugehörigkeit und Autorschaft befragt. Wenn die Vorlesung die Bindestrich-Konstruktion dennoch im Titel trägt, so gewissermaßen in Anführungszeichen: als Gegenstand einer vielstimmigen, oft kontroversen Erkundung in unterschiedlichen historischen und gegenwärtigen Konstellationen, in denen nicht nur ihre Verbindung, sondern auch die beiden Begriffe, aus denen sie gefügt ist, als solche zur Disposition stehen. Beispielhafte Lektüren literarischer Texte aus vier Jahrhunderten werden in diskursgeschichtliche Kontexte eingebettet und durch Erläuterungen und Problematisierungen wichtiger Schlüsselbegriffe (Diaspora, Zionismus, Emanzipation, Haskala, Assimilation, Symbiose, Orient, Kosmopolitismus, Kleine Literatur, Transnationalität etc.) flankiert.
Doerte Bischoff: Anna Seghers. Politik und Ästhetik (Seminar II)
Vor allem durch ihre im Exil entstandenen Romane, Das Siebte Kreuz und Transit ist Anna Seghers bis heute als Autorin bekannt, die zeithistorische Ereignisse des 20. Jahrhunderts, nationalsozialistische Verfolgung und Widerstand, Flucht und Exil, auf eine Weise gestaltet, die Zeitzeugenschaft mit Gesellschaftsanalyse verbindet. Dabei zeichnen sich ihre Texte durch eine enge Bezogenheit von politischer Reflexion und ästhetischer Form aus, welche die Frage, ob und inwiefern es sich hier um ‚engagierte Literatur‘ handelt, als eine komplexe, nicht einfach und nicht einheitlich zu beantwortende aufwirft. Seghers, die sich bereits in den 1920er Jahren zum Kommunismus bekannt hatte und die im Exil (in Frankreich und Mexiko) antifaschistische Initiativen und Institutionen maßgeblich mittrug, prägte nach ihrer Rückkehr nach Deutschland als Präsidentin des Schriftstellerverbandes das kulturelle Leben in der DDR. In Zeiten des Ost-West-Konflikts sind in der Rezeption manche Zwischentöne und produktive Ambivalenzen, die viele ihrer Texte kennzeichnen, aus dem Blick geraten. Erst allmählich hat sich die Wahrnehmung für Aspekte ihres Werks geöffnet, welche die Vorstellung von einer politischen Autorin mit erwartbarer Positionierung unterlaufen. Im Seminar soll anhand dreier Romane (neben den genannten Der Kopflohn) und einer Auswahl von Erzählungen, Essays, Reden und Briefen untersucht werden, wie Zugehörigkeit – in Bezug auf nationale, politische, aber auch kulturelle und religiöse Kollektive und Kontexte – als vielschichtig und dynamisch reflektiert wird. Gefragt werden soll nach der Rolle christlicher und jüdischer Motive und Traditionen ebenso wie nach der erzählerischen Adaption von Märchen und Mythen und spezifischen Schreibweisen des Phantastischen. Zugleich wird gefragt, wie Funktionen und Exzesse moderner Bürokratie literarisch inszeniert werden. Darüber hinaus sollen Konstellation von Gender und Interkulturalität nachvollzogen und kritisch diskutiert werden. Die Analyse der Erzähltexte wird durch Lektüren poetologischer Texte von Seghers ergänzt, in denen sie – etwa im Rahmen der sogenannten Expressionismusdebatte – ihr Schreiben als modernes, Avantgarde-Techniken verpflichtetes, eingehend reflektiert.
Sommersemester 2023
Finja Zemke: Szenen der Nachbarschaft in der Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts (IntLit) (Seminar Ib)
Nachbarschaft zeichnet sich im soziologischen Verständnis zum einen durch räumliche Nähe zum anderen durch soziale Interaktionen aus. Durch die Mobilität in einer zunehmend globalisierten Welt, die steigende Pluralisierung und die Veränderung des Verhältnisses von Nähe und Ferne stellt sich auf neue Weise die Frage, was Nachbarschaften im 20. und 21. Jahrhundert ausmacht.
Methodisch werden wir Texte aus unterschiedlichen Kontexten ‚in Nachbarschaft setzen‘, die uns durch die Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts führen, um diese Frage an ausgewählte literarische Darstellungen nachbarschaftlicher Konstellationen zu stellen. Wir untersuchen zum einen Texte, die die moderne Großstadt literarisch dokumentieren und das Nebeneinanderwohnen auf engstem Raum, aber auch die Anonymität und empfundene Bedrohung durch den fremden Nachbarn thematisieren. Dabei rückt auch das ‚Unheimliche‘ dieser Beziehung in den Fokus.
Mit dem Blick auf literarische Texte, die vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges entstanden sind, wird eine Zäsur sichtbar: Die massenhafte Vertreibung und Vernichtung von Menschen haben nachbarschaftliche Beziehungen gebrochen. Der Rabbiner Joachim Prinz hat 1935 geschrieben: „Des Juden Los ist: nachbarlos zu sein“ – im Zuge der gemeinsamen Lektüre gehen wir u. a. der Frage nach, wie jüdische Texte nach 1945 diesen Gedanken reflektieren.
Auch durch gegenwärtige Exil- und Migrationserfahrungen entstehen nachbarschaftliche Konstellationen von Menschen mit unterschiedlichen Normen und Gewohnheiten. Nachbarschaft impliziert in diesem Kontext häufig eine Ko-Existenz und bleibende Differenz, erzählt aber auch von dem Wunsch nach Solidarität und gegenseitiger Wertschätzung. Was erfahren wir in jenen Texten über das Gelingen oder Misslingen von Nachbarschaft? Diese Frage stellen wir auch an literarische Texte, die nicht den Kontext von Exil und Migration aufgreifen. Sie verhandeln Nachbarschaft häufig vor dem Hintergrund eines Konflikts wie etwa der ‚Klimakrise‘.
Auswahl literarischer Texte:
„Der Nachbar“ (Franz Kafka); „Zwischenstationen“ (Vladimir Vertlib); „Vielleicht Esther“ (Katja Petrowskaja); „Der Hof im Spiegel“ (Emine Sevgi Özdamar); „Herkunft“ (Saša Stanišic), „Unterleuten“ (Juli Zeh); „Zusammen“ (Simone Dede Ayivi).
Wintersemester 2022/2023
Doerte Bischoff: Israel und Palästina in der deutschsprachigen Literatur (Seminar II)
Parallel zur Frage der Emanzipation und Assimilation wird in der von Juden und Jüdinnen verfassten deutschsprachigen Literatur immer wieder auch die Perspektive eines anderen jüdischen Ortes ins Spiel gebracht. Palästina bzw. (nach der Staatsgründung 1948) Israel erscheint als Projektionsfläche für Imaginationen und Idealisierungen, die der oft problematischen Situation eines von Antisemitismus und Marginalisierung geprägten Lebens in Europa entgegengesetzt wird. Zionistische Visionen von einem 'Altneuland' (Theodor Herzl), die unter Bezugnahme auf historische und mythische Narrative von einer wiederzugewinnenden jüdischen Heimat in Palästina handeln, gewinnen angesichts massiver Verfolgungen im 20. Jahrhundert an Attraktivität und werden durch Migration, Siedlungsprojekte und Staatenbildungsprozesse zunehmend konkret. Viele Autor*innen, deren Texte in Palästina/Israel spielen, haben das Land bei Reisen, aber auch als aus Europa Geflüchtete bzw. aus zionistischer Überzeugung Eingewanderte intensiv kennengelernt und nicht selten unter konflikthaften Bedingungen mitgestaltet. Ihre auf Deutsch geschriebenen Texte verhandeln dabei vielfach Zugehörigkeit im Spannungsfeld unterschiedlicher Loyalitäten und Lebensräume, wodurch nationale Bekenntnisse auf verschiedene Weise problematisiert erscheinen. Das Seminar gibt Einblicke in literarische Reflexionen auf die (Vor-)Geschichte des Staates Israel und diskutiert an ausgewählten Texten (von Arnold Zweig, Else Lasker-Schüler, Arthur Koestler, Jenny Aloni, Doron Rabinovici, Vladimir Vertlib, Olga Grjasnowa und Dimitrij Kapitelman), wie Heimat und Exil, Israel und die Diaspora im Horizont zionistischer Diskurse, aber auch angesichts der Shoah jeweils verhandelt werden. Gefragt werden soll dabei auch, inwiefern deutschsprachige jüdische Literatur über Palästina/Israel dynamische Verortungen und transnationale Identitäten entwirft, die gerade auch in Gegenwartsdebatten über Zugehörigkeit und alternative Gemeinschaftsformen Relevanz besitzen.
Arnold Zweigs "De Vriendt kehrt heim" (Anschaffung ggf. antiquarisch über ZVAB u.ä.) sollte vor Seminarbeginn gelesen werden.
Zur Einführung:
Gershom Scholem: Israel und die Diaspora, in: ders.: Judaica 2, Frankfurt/M. 1970, S. 55-76;
Jürgen Nieraad: Deutschsprachige Literatur in Israel, in: Erwin Th. Rosenthal: Deutschsprachige Literatur des Auslandes, Bern 1989, S. 83-100;
Agnes C. Mueller: Israel as a Place of Trauma and Desire in Contemporary German Jewish Literature, in: In: Spiritual Homelands. The Cultural Experience of Exile, Place and Displacement Among Jews and Others, hg. v. Asher D. Biemann, Richard I. Cohen u. Sarah Wobick-Segev. Berlin 2019, S. 253-275.
Sommersemester 2022
Doerte Bischoff: Sans Papiers: Literatur und Staatenlosigkeit (IntLit) (Seminar II / Teilpräsenz)
Menschen ohne Papiere befinden sich in einem prekären Zustand: wer keine Zugehörigkeit zu einem Staat nachweisen kann oder ohne Aufenthaltsgenehmigung in einem anderen Staat lebt, hat keinen gleichberechtigten Zugang zu Schutz und Rechten. Darüber hinaus schränkt Papierlosigkeit auch die Beweglichkeit ein, denn Pässe (und die eingestempelten Visa) sind, worauf schon der Ursprung des Begriffs verweist, unerlässlich auch für Grenzüberschreitungen. Mit dem französischen Begriff ‚Sans Papiers‘, der sich auch in anderen Sprachen etabliert hat, greift das Seminar eine neuere Debatte um die Rechte ‚undokumentierter‘ Migranten auf und verfolgt das Sujet der Papierlosen in der Literatur. Dabei ist zu fragen, wie die Perspektive derjenigen, die vielfach unsichtbar und ohne Stimme sind, zur Sprache kommt und wie etwa wie Konstellationen von Bewegung und Stillstand sowie von Transiträumen und Grenzzonen gestaltet werden. Darüber hinaus soll gefragt werden, ob und inwiefern literarische Texte Papierlosigkeit auch als Chance und Alternative in Szene setzen.
Die enge Verschränkung von personaler Identität und staatlicher Bürokratie der Identifikation ist ein historisches Phänomen, das mit der Entstehung der Nationalstaaten Ende des 18. Jahrhunderts virulent wird und vor allem im 20. Jahrhundert angesichts von Kriegen, politischer Neuordnungen sowie von ethnonationaler Homogenisierung, Vertreibung und Verfolgung seine Widersprüche und Gefahren offenbart. Diese sind auch in der Gegenwart trotz des vermehrten Schutzes von Geflüchteten und Staatenlosen auf internationaler Ebene noch immer präsent. Zu fragen ist, inwiefern literarische Texte Kontinuitäten, aber auch historische Unterschiede und aktuelle Dynamiken reflektieren und auch, ob die vor allem die für das 20. Jahrhundert zentralen Analysen von Hannah Arendt in der Gegenwart ihre Aussagekraft behalten haben.
Nach einer Einstiegslektüre von Lawrence Sternes Sentimental Journey (auch in deutscher Übersetzung), sollen deutschsprachige Erzähltexte, Dramen und Feuilletons der Zwischenkriegszeit (Kafka, Tucholsky, Joseph Roth, B. Traven, Zuckmayer, Horváth) sowie des Exils und Nachexils (Seghers, Remarque, Werfel, Keun, Drach, Aichinger) gemeinsam gelesen und diskutiert werden. Schließlich sollen auch Gegenwartstexte z.B. von Hamid Skif, Merle Kröger, Julya Rabinowich, Tanja Maljatschuk und Abbas Khider einbezogen werden.
Empfohlene Lektüre vor Seminarbeginn: B. Traven: Das Totenschiff; Albert Drach: Unsentimentale Reise; Merle Kröger: Havarie
Kontextliteratur zur Vorbereitung: Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (Kap. II/9: Der Niedergang des Nationalstaates und das Ende der Menschenrechte); Donatella di Cesare: Philosophie der Migration; Thomas Claes: Passkontrolle! Eine kritische Geschichte des sich Ausweisens und Erkanntwerdens.
Sommersemester 2021
Doerte Bischoff, Susanne Rohr: Anne Frank in Deutschland und den USA: Zeugnis, Autorschaft und Medialisierung (T/M) (IntLit) (Seminar II / digital)
Das Tagebuch der Anne Frank gehört zu den bekanntesten Texten weltweit. Es wurde in über 70 Sprachen übersetzt und von der UNESCO in das Weltdokumentenerbe aufgenommen. Tatsächlich kann es als eindrückliches Zeugnis von Verfolgung und Exil während der NS-Zeit gelesen werden: von den Schwierigkeiten und Chancen im Exilland, hier den Niederlanden, in die die Familie Frank 1934 mit den beiden Töchtern emigrierte, vor allem aber vom Leben im Versteck in ständiger Angst vor Entdeckung und Deportation. Dass das Tagebuch zu einer Chiffre für die Erinnerung an die Shoah wurde, der seine Verfasserin schließlich zum Opfer fiel, ist bemerkenswert, denn Lagerrealität und massenhaftes Sterben sind gerade nicht Gegenstand des Textes. Offensichtlich bot sich die Adoleszenzgeschichte eines jungen Mädchens, in der einmal auch ein unerschütterlicher Glaube an ‚das Gute im Menschen‘ artikuliert wird, besonders für Rezeptionen an, die eine Auseinandersetzung mit den Abgründen von Ausgrenzung und Genozid scheuten und stattdessen Anknüpfungspunkte für naive Humanismus- und Versöhnungskonzepte suchten. In den USA ist das Tagebuch der meistgelesene Text zum Holocaust und Pflichtlektüre an den meisten Schulen. Die Figur der Anne Frank wird hier durch die Kraft ihrer literarischen Hinterlassenschaft als survivor und nicht als Opfer gedeutet, und ihr Tagebuch „has long been the most important landmark in the Americanization of the Holocaust“, wie die amerikanische Kulturwissenschaftlerin Hilene Flanzbaum ausführt. Die Eigenheit der Perspektive und die literarische Ambition, die den Text auch auszeichnet, geriet in der ikonisierenden Rezeption dabei vielfach völlig aus dem Blick. Dies Spannungsverhältnis wird gerade in literarischen Texten, die sich auf Anne Frank beziehen, sie als Figur wiederaufleben lassen und über die Mechanismen ihrer Symbolwerdung und Funktion in multimedial inszenierten Erinnerungsdiskursen reflektieren, facettenreich gestaltet. Auch in der Forschung und in neueren Editionen wird zunehmend nach der Literarizität des Textes, seinem Entstehungsprozess, nach dem Zusammenhang von Autorschaft und Weiblichkeit sowie nach verschiedenen Formen der Rezeption und des Nachlebens gefragt.
Im Seminar soll der Text des Tagebuchs (mit Bezug auf seine Editionsgeschichte) als literarisches Zeugnis diskutiert werden, darüber hinaus wird die mediale Rezeption in Deutschland und in den USA in den Blick genommen, die jeweils durch unterschiedliche Phasen bestimmt sind. Im Zentrum stehen literarische Texte (z.B. Philipp Roth "The Ghostwriter", Shalom Auslander "Hope. A Tragedy", Barbara Honigmann „Ich bin nicht Anne“ u.a.), Graphic Novels, essayistische Würdigungen (wie Francine Prose "Anne Frank: the book, the life, the afterlife"), aber auch Theateradaptionen und Verfilmungen.
Bitte beachten Sie: Da das Seminar fächerübergreifend unterrichtet wird, ist die Seminarsprache Deutsch. Die englischen Texte werden jedoch n i c h t in Übersetzung gelesen.
Zur Vorbereitung:
Bloom, Harold (Hg.), A Scholarly Look at The Diary of Anne Frank, edited and with an introduction by Harold Bloom, Philadelphia 1999;
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara, Jeffrey Shandler, Anne Frank Unbound. Media, Imagination, Memory, Bloomington 2012;
Ozick, Cynthia, Who owns Anne Frank?, in: The New Yorker October 1997;
Stern, Frank, Worüber sie reden, wenn wir von Anne Frank sprechen … Zum interkulturellen Nachleben einer Erinnerungsikone, in: Anne Frank. Mediengeschichte, hg. v. Peter Seibert, Jana Piper, Alfonso Meoli, Frankfurt/M. 2014, 253-268.
Wintersemester 2020/2021
Doerte Bischoff: Transnationalität und Literatur (IntLit) (Seminar II + Übung / digital)
Migration, Globalisierung und digitale Netzwerke prägen nicht nur soziale, politische und ökonomische Strukturen heutiger Gesellschaften, sie haben auch einen erheblichen Einfluss auf Produktions- und Rezeptionskontexte von Literatur, auf Motive und Schreibweisen literarischer Texte sowie auf das Selbstverständnis der literaturwissenschaftlichen Disziplinen. Literatur, die sich zwischen den Kulturen ansiedelt, die Phänomene kultureller Entgrenzung, Übersetzung und Hybridisierung, von Exophonie und Translingualität prominent verhandelt und produktiv werden lässt, lässt sich nicht mehr ohne Weiteres im ‚Container‘ der klassischen Nationalphilologien verorten. Transnational sind literarische Texte dann, wenn sie das Zusammenspiel von kulturellen und politischen Formen der Kohärenzstiftung und Grenzsetzung als solches reflektieren. Im Seminar sollen zunächst Texte gelesen werden, welche die Verschränkung von Nationaldiskurs und Literatur(wissenschaft) zu Beginn des 19. Jahrhunderts besonders eindrücklich dokumentieren, indem sie sie entweder affirmieren (Herder, E.M. Arndt, Kleist) oder auf unterschiedliche Weise transformieren (Goethe, Heine, Brentano). Angesichts des inzwischen vielfach reflektierten Befundes, dass die Vorstellung von der Nation als einheitliche und abgrenzbare kulturelle Größe eine imaginäre Setzung (B. Anderson) darstellt, die narrativ erzeugt wird (H. Bhabha), soll eine Auswahl literarischer Texte diskutiert werden, welche nationale Narrative unterlaufen und ihre Grenzsetzungen zur Disposition stellen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Literatur deutsch-jüdischer Autor/innen, ein anderer auf der Literatur der Gegenwart (z.B. B. Honigmann, V. Vertlib, D. Dinev, E. Özdamar, T. Mora, M. Biller, O. Grjasnowa, A. Khider). Im Vergleich der Texte und im Bezug auf aktuelle Diskussionen um Post- bzw. Transnationalität sollen schließlich verschiedene Modelle literarisch inszenierter Transnationalität differenziert werden.
Literatur:
Doerte Bischoff, Svetlana Arnaudova (Hg.): Figuren des Transnationalen. (Re-)Visionen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Dresden 2020;
Doerte Bischoff, Susanne Komfort-Hein (Hg.): Handbuch Literatur & Transnationalität, Berlin 2019;
Stuart Taberner: Transnationalism and German-Language Literature in the Twenty-First Century, Cham 2017;
Paul Jay: Global Matters. The Transnational Turn in Literary Studies, Ithaca 2010;
Frank Schulze-Engler: Transnationale Kultur als Herausforderung für die Literaturwissenschaft, in: ZAA 50.1 (2002), S. 65-79;
Ottmar Ette: ZwischenWeltenSchreiben. Literaturen ohne festen Wohnsitz, Berlin 2005.
Sommersemester 2020
Doerte Bischoff: Fluchtgeschichten: Narrative, Genres, Intertextualität (Vorlesung und Übung / digital)
Dass seit einigen Jahren verstärkt Menschen, die vor Krieg, Elend und Verfolgung geflohen sind, in Westeuropa Zuflucht gesucht haben, hat nicht nur politische und juristische Debatten über Grenzen, Asylmodalitäten und Formen des Zusammenlebens provoziert, sondern auch in den Literatur- und Kulturwissenschaften zu einer neuen Aufmerksamkeit auf kulturelle Verhandlungen von Flucht geführt.
Die Vorlesung, in der mehrmals Vortragende aus anderen Disziplinen zu Gast sein werden, behandelt literarische und kulturtheoretische Texte aus verschiedenen historischen Epochen, die von spezifischen Konstellationen der Ausgrenzung, Vertreibung und Exilierung Zeugnis ablegen. Gefragt wird dabei, inwiefern Literatur spezifische und übergreifende Narrative von Flucht generiert, verzeichnet und vielfach auch unterläuft. Inwiefern, so soll weiter gefragt werden, lassen sich dabei wiederkehrende Strukturen und Vernetzungen zwischen Texten über Flucht und Entortung erkennen, die transhistorische und transnationale Bezüge erkennbar werden lassen? Und inwiefern entfalten solche vernetzte Texte das Potential, machtvolle Grenzziehungen und kulturelle Einhegungen von Menschen und Literaturen zu analysieren und zu überschreiten? Inwiefern schreiben sich gerade auch Gegenwartstexte zur Fluchtthematik über solche intertextuellen Verweise in die deutschsprachige Literatur ein, deren nationalen Container sie ebenso in Frage stellen wie implizite eurozentrische Orientierungen?
Anhand der Beispielanalysen soll auch ein Bewusstsein für diskursgeschichtliche Resonanzräume zentraler Begriffe (wie dem des Flüchtlings oder des Exilanten) geweckt werden. Intermediale Bezüge werden vor allem in Bezug auf Comics und Graphic Novels, vereinzelt auch in Referenzen auf Film und bildende Kunst einbezogen.
Zum Einlesen:
Hannah Arendt: Wir Flüchtlinge. Stuttgart (Reclam) 2016; Doerte Bischoff, Johannes Evelein u. Simona Leonardi (Hg.): Fluchtgeschichten. Narrative Grenzerkundungen angesichts von Emigration und Exil. In: Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 – Germanistik zwischen Tradition und Innovation, hg. v. Jianhua Zhu, Michael Szurawitzki und Jin Zhao, Bd. 9, Frankfurt/M. u.a. 2017, S. 193-312; Burcu Dogramaci u. Elizabeth Otto (Hg.) Passagen des Exils (Jahrbuch Exilforschung 34/2017); Thomas Hardtke, Johannes Kleine, Charlton Payne (Hg.): Niemandsbuchten und Schutzbefohlene. Flucht- Räume und Flüchtlingsfiguren in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Göttingen 2017; Eva Horn: Der Flüchtling. In: Grenzverletzer. Von Schmugglern, Spionen und anderen subversiven Gestalten. Hg. v. ders u.a. Berlin 2002, S. 23-40; Michael Marrus: Die Unerwünschten. Europäische Flüchtlinge im 20. Jahrhundert, Berlin 1999.
Doerte Bischoff: Flucht und Gender (Seminar II und Übung bzw. Koll. / digital)
Erfahrungen von Flucht und Exil sind häufig an radikale Brüche mit bisherigen Lebensordnungen geknüpft. Dazu gehört vielfach auch eine spezifische Geschlechterordnung, die durch die Bedingungen und Erfordernisse der Flucht, aber auch durch Regeln, Gesetze und kulturell geprägte Vorstellungen im Aufnahmeland in Frage gestellt werden kann. Das kann Orientierungsverlust und ein Gefühl der Unbehaustheit zur Folge haben, aber auch zuvor unvorstellbare Möglichkeiten eröffnen und das Gekannte seiner vermeintlichen Natürlichkeit und Alternativlosigkeit entkleiden. In vielen literarischen Texten, die Flucht und Exil reflektieren, spielen Genderkonstellationen, ihre Dynamisierung und Kontingenz, eine zentrale Rolle. Im Seminar stehen sowohl kanonische und weniger bekannte Texte im Fokus, die das historische Exil seit 1933 behandeln, es soll aber auch danach gefragt werden, inwiefern das Thema in der aktuellen deutschsprachigen Literatur sowie in Graphic Novels und Filmen, die sich mit Flucht und Exil als Signatur der Vergangenheit und Gegenwart beschäftigen, präsent ist.
Behandelt werden Texte von Judith Kerr, Lisa Fittko, Hilde Domin, Irmgard Keun, Alice Rühle-Gerstel, Adrienne Thomas, Hilde Spiel, Anna Seghers, Norbert Gstrein, Marjane Satrapi, Reinhard Kleist, Abbas Khider und Elfriede Jelinek. Alice Rühle Gerstels "Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit", Norbert Gstreins "Die englischen Jahre" sowie Abbas Khiders "Ohrfeige" sollten möglichst vor Seminarbeginn gelesen werden. Forschungsliteratur zum Einlesen:
Sabine Rohlf: Exil als Praxis – Heimatlosigkeit als Perspektive? Lektüre ausgewählter Exilromane von Frauen, München 2002; Marion Schmaus: Exil und Geschlechterforschung. In: Handbuch der deutschsprachigen Exilliteratur. Von Heinrich Heine bis Herta Müller. Hg. v. Bettina Bannasch und Gerhild Rochus. Berlin, Boston 2013, S. 121–147; Helma Lutz, Anna Amelina: Gender, Migration, Transnationalisierung. Eine intersektionelle Einführung, Bielefeld 2017; Elena Fiddian-Qasmiyeh: Gender and Forced Migration, in: The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies. Hg. v. ders. u.a., Oxford 2016,
S. 395-408.
Finja Zemke: Das Fortleben der Avantgarde im Exil (Seminar Ib / digital)
Die literarischen und künstlerischen Avantgarde-Bewegungen, die sich während des Ersten Weltkrieges zu bilden begonnen hatten, waren eng mit der Überzeugung verbunden, dass die aus den Trümmern des Krieges neu aufzubauende Gesellschaft auch einer neuen Ästhetik bedürfe. Dem Konzept des L’art pour l’art (Kunst um der Kunst willen) sollte eine durch Formexperimente gekennzeichnete Kunst entgegengestellt werden, die an der Lebenspraxis der Menschen ansetzt.
Die Zeit des Umbruchs und der Revolutionen am Ende des Ersten Weltkrieges ist wie die Zeit der Weimarer Republik nicht ohne die künstlerischen Avantgarden zu denken. Hingegen galt vom Schreiben im NS-Exil lange die Auffassung, es stelle das Ende der avantgardistischen Kunst dar: Um 1930 – so jedenfalls beurteilen es bedeutende Stimmen der Zeit – sei die Epoche der Form-Experimente vorüber und ein traditionelleres realistisches Schreiben sei in den Vordergrund getreten. Doch auch wenn bedeutende Texte der künstlerischen Avantgardebewegung von den Nationalsozialisten verboten wurden und es auch unter Exilautor*innen eine Hinwendung zu traditionelleren Genres und Schreibweisen gab, lassen sich charakteristische Ästhetiken der Avantgarde auch in den Schreibverfahren deutschsprachiger Exilautoren vielfach noch lesen.
In diesem Seminar begeben wir uns auf die Spurensuche nach avantgardistischen Schreibverfahren im Exil. Wir widmen uns Texten der Avantgarde der 1920er Jahre wie auch der sogenannten Expressionismusdebatte im Exil und Texten des historischen Exils seit 1933 von Konrad Merz, Else Lasker-Schüler, Anna Seghers, Hans Sahl u. a. Darüber hinaus sollen einzelne Gegenwartstexte, die Flucht und Exil verhandeln (z. B. Saša Stanišić) daraufhin befragt werden, inwiefern hier Bezüge zu Avantgarde-Ästhetiken erkennbar sind.
Lektüre zum Einlesen:
Bürger, Peter: Theorie der Avantgarde. Mit einem Nachwort zur 2. Auflage. Frankfurt am Main 1974; Exilforschung. Ein Internationales Jahrbuch 16 (1998): Exil und Avantgarden.
Wintersemester 2019/2020
Doerte Bischoff: Vernetzte Geschichte(n): Transnationalität und Erinnerung in der Gegenwartsliteratur (Seminar II)
Um sich der eigenen Identität und Herkunft zu vergewissern, müssen Geschichten erzählt werden. Das gilt sowohl für individuelle Versuche, eine möglichst kohärente Lebens- und Generationengeschichte zu (er-)finden, wie auch für Gruppen oder Nationen, die ihr Selbstverständnis auf Narrative kollektiver Erinnerung stützen. Quellen und Spuren historischer Ereignisse sowie Erinnerungsobjekte werden dabei jeweils spezifisch gedeutet und zu einer zusammenhängenden Erzählung gefügt. Nationale Erinnerungsdiskurse, die etwa durch staatlich inszenierte Gedenkrituale und Gedenkstätten etabliert werden, stellen häufig einen wichtigen Bezugspunkt auch für individuelle Erinnerungen dar. Was aber, wenn durch transnationale Medien und Migration herrschende kollektive Erinnerungsdiskurse mit anderen, widerstreitenden oder einfach anders gelagerten Erinnerungen konfrontiert werden?
Das Seminar untersucht literarische Gegenwartstexte z.B. von Emine Sevgi Özdamar, Zafer Senocak, Maja Haderlap, Saša Stanišic, Katja Petrowskaja, Nino Haratischwili, Doron Rabinovici oder Robert Menasse, die auf unterschiedliche Weise die Verschiedenheit individueller und kollektiver Erinnerung an die oft von extremer Gewalt geprägten Geschichte(n) im 20. und 21. Jahrhundert reflektieren. Indem gerade Familien-Geschichten von Exilierten und MigrantInnen quer zu den verschiedenen nationalen Narrativen stehen, werden gleichzeitig Formen vernetzter Geschichte(n) erkennbar. Dies soll, auch im Rekurs auf neuere gedächtnistheoretische Studien zu transnationaler oder multidirektionaler Erinnerung bzw. zur 'Histoire Croisée' (z.B. von Aleida Assmann, Michael Werner und Bénédicte Zimmermann, Daniel Levy und Natan Sznaider, Michael Rothberg oder Astrid Erll) gemeinsam erarbeitet werden.
Maja Haderlaps "Engel des Vergessens" und Katja Petrowskajas "Vielleicht Esther" sollte vor Seminarbeginn gelesen werden. Nino Haratischwilis umfangreichen Roman "Das achte Leben. Für Brilka" werden wir in Auszügen lesen.
Zur Einführung:
Erll, Astrid. Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart: Metzler, 2017; Anja Tippner: Erinnerung und Transnationalität, in: Literatur & Transnationalität. Ein kulturwissenschaftliches Handbuch, hg. v. Doerte Bischoff und Susanne Komfort-Hein, Berlin: De Gruyter 2019.
Sommersemester 2019
Doerte Bischoff: Franz Werfel: ein jüdischer Autor in Zeiten der Krise (Seminar II)
Wer "Barbara oder die Frömmigkeit" oder "Das Lied von Bernadette" kennt, zwei viel gelesene Romane Franz Werfels, die ihn zu einem der bekanntesten Autoren seiner Zeit, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gemacht haben, kennt, dürfte zunächst über die Fokussierung Werfels als ‚jüdischem Autor‘ verwundert sein. Deutlich werden hier christliche Figuren und Legenden literarisch bearbeitet. Auch die ersten expressionistischen Gedichte und Dramen Werfels, der dem assimilierten Milieu des Pragerdeutschen Judentums entstammte, sind kaum mit Fragen jüdischer Identität und Tradition befasst. Dies ändert sich in der Zwischenkriegszeit, in der etwa die ‚dramatische Legende‘ "Paulus unter den Juden" (1926) erscheint, die die Frage der Spaltung von Judentum und Christentum, aber auch ihrer Korrespondenzen und Berührungspunkte verhandelt. Auslöser für die intensive Beschäftigung mit jüdischen Stoffen und Konstellationen sind prägende Palästina-Reisen, die Auseinandersetzung mit dem Zionismus und generell Debatten über die sogenannte jüdische Renaissance, aber auch der wachsende Antisemitismus. Seit 1933 entstehen etwa der historische Roman "Jeremias. Höret die Stimme" (1936/37) als ‚jüdisches Gegenstück‘ zu Werfels ‚christlichen‘ Romanen oder das Drama "Die Verheißung" (1935), das 1937 von Kurt Weill vertont und in New York uraufgeführt wurde. Die Perspektive auf jüdische Figuren führt dabei, wie etwa das Exildrama "Jacobowsky und der Oberst" (1944) zeigt, auch zur Problematisierung von Staatsbürgerschaft und Zugehörigkeit mit den Mitteln von Komik und Groteske. Neben literarischen und essayistischen Texten, die christlich-jüdische Konstellationen sowie das Verhältnis von Literatur und Religion unter den Bedingungen der Moderne reflektieren, sollen im Seminar auch Texte mit explizitem Zeitbezug gelesen werden, die wie "Eine blaßblaue Frauenschrift" oder "Cella oder Die Überwinder" das Schicksal jüdischer Menschen angesichts von antisemitischer Verfolgung und Exilierung gestalten.
Zur Einführung: Armin A. Wallas: Franz Werfel, in: Metzler Lexikon der Deutsch-Jüdischen Literatur, hg. v. Andreas Kilcher, Stuttgart 2000, S. 611-616; Peter Stephan Jungk: Frank Werfel. Eine Lebensgeschichte. Frankfurt/Main 1987.
Doerte Bischoff: Das Ende der Fiktionen: Wolfgang Hildesheimer als Nachkriegsautor (Seminar II)
Wolfgang Hildesheimer ist zugleich herausragender Repräsentant wie Außenseiter und Grenzgänger der deutschen Nachkriegsliteratur. Dass man nach 1945, nach Nationalsozialismus und Shoah, zumal in deutscher Sprache nicht bruchlos an Traditionen anknüpfen konnte, diese Überzeugung teilte er mit anderen VertreterInnen der 'Gruppe 47', der er 1951 beitrat. Zugleich sind seine in den ersten Nachkriegsjahrzehnten entstandenen Texte von einer ganz eigenen, in manchem radikalen Perspektive und Schreibweise geprägt. Bereits in den "Lieblosen Legenden" (1952) werden mit Mitteln der Satire und Groteske kulturelle Ordnungen und Autoritäten in ihrer Prekarität und Abgründigkeit vorgeführt. Ein zentrales Interesse Hildesheimers gilt der Frage, wie kohärente, sinnhafte Erzählungen, auch im Hinblick auf Lebensentwürfe und Biografien, angesichts der Kontingenz und Sinnlosigkeit der modernen Welt entstehen können. Dabei wird, wie etwa in den fiktionalisierten (Anti-)Biografien "Mozart" (1977) "Marbot" (1981), die Konstruktion kultureller Ordnung und Bedeutung jeweils von Absurdität und Diskontinuität heimgesucht. In seiner Theorie des Absurden orientiert sich Hildesheimer, der insgesamt von vielfältigen Einflüssen der europäischen Moderne geprägt war, an Beckett, Joyce und Ionesco. Einer Zuordnung zu einer national gedachten Literatur, der sich seine Texte auf vielfältige Weise widersetzen, hat Hildesheimer selbst immer wieder zurückgewiesen. Als Jude, der 1933 mit der Familie nach Palästina emigrierte, prägende Jahre in England gelebt hatte und nach einigen Jahren im Nachkriegsdeutschland sich 1957 für einen Wohnsitz in der Schweiz entschied, stand er nationalen Verortungen distanziert und skeptisch gegenüber. Gleichwohl oder vielleicht gerade deshalb gehören etwa seine Romane "Tynset" (1965) und "Masante" (1973), die Erzählperspektiven von Grenzorten her entwickeln, zu den eindrücklichsten Literarisierungen der ‚deutschen Katastrophe‘. Das Seminar will dieses Spannungsfeld erkunden und Hildesheimer auch als Übersetzer in den Blick nehmen, der nicht nur zentrale Texte der europäischen Moderne ins Deutsche übertrug, sondern dessen Arbeit als Simultanübersetzer bei den Nürnberger Prozessen auch seine literarische Arbeit nachhaltig prägte. Aktuelle Forschungen, die anlässlich des Jubiläumsjahrs (2016 wäre Hildesheimer 100 Jahre alt geworden) neue Perspektiven auf das Werk profiliert haben, sollen in die Seminararbeit einbezogen werden.
Zur Einführung: Stephan Braese: Jenseits der Pässe. Wolfgang Hildesheimer. Eine Biographie, Göttingen 2016; Günter Blamberger: Wolfgang Hildesheimer, in: Metzler Autoren Lexikon, Stuttgart 1986, S. 281f; Wolfgang Hildesheimer: Das Ende der Fiktionen. Reden aus fünfundzwanzig Jahren, Frankfurt/M. 1993.
Wintersemester 2018/2019
Doerte Bischoff: Fernes Grab: Totengedenken und Migration in der Literatur (Seminar II)
Erfahrungen von Exil und Migration verbinden sich häufig mit der Frage, ob und inwiefern das Land der Zuflucht eine neue Heimat werden kann und wie dies das Verhältnis zum Herkunftsland beeinflusst. In der literarischen und künstlerischen Auseinandersetzung mit diesem Komplex spielen dabei nicht nur die (Selbst-)Verortungen der Lebenden eine Rolle, sondern auch die Orte der Toten. Gräber und Friedhöfe werden vielfach als exemplarische Stätten der Erinnerung reflektiert, die nicht mehr in der Nähe gelegen und oft nicht ohne Weiteres zugänglich und begehbar sind, wodurch traditionelle Formen eines für die Stiftung sozialer und kultureller Kohärenz bedeutsamen Totengedenkens problematisch werden. Gleichzeitig stellen Exilanten wie bei Heinrich Heine immer wieder auch die Frage, wo ihre eigene, des „Wandermüden letzte Ruhestätte[,] sein“ wird. Im Seminar sollen Texte (und Filme) daraufhin untersucht werden, wie sie dieses Dilemma artikulieren und welche alternativen Formen des Gedenkens in der Auseinandersetzung mit Traditionen einer letzten, eindeutig territorial verortbaren Ruhestätte entworfen werden. Dabei wird es nicht nur um z.T. groteske ‚Mobilisierungen‘ von Särgen, Grabstätten und Grabsteinen und um Hybridisierungen von Friedhofsanlagen und Bestattungszeremonien gehen, sondern auch um die Frage, inwiefern das Phänomen der Grablosigkeit, das das durch Krieg und Genozid geprägte 20. Jahrhundert wesentlich bestimmt, Spuren in den Texten hinterlassen hat.
Zur Diskussion stehen u.a. Texte von Hilde Domin, Joseph Roth, Barbara Honigmann, Dimitre Dinev, Vladimir Vertlib, Melinda Nadj Abonji, Katja Petrowskaja, Emine Sevgi Özdamar, Sibylle Lewitscharoff und Adriana Altaras sowie Fatih Akins Film "Auf der anderen Seite".
Sommersemester 2018
Doerte Bischoff, Anja Tippner: Terezín/Theresienstadt: Dokumentation und Literarisierung (Seminar II, mit Exkursion)
Das gemeinsame Seminar (Slavistik/Germanistik) wendet sich dem Ghetto in Terezín/Theresienstadt zu. Es nahm im nationalsozialistischen Lagersystem eine Sonderstellung ein, da es als „Vorzeigelager“ galt. Darüberhinaus ist es durch eine reiche Kulturproduktion gekennzeichnet, die gut dokumentiert ist. Mit H.G. Adlers "Theresienstadt. Antlitz einer Zwangsgemeinschaft" liegt für Terezín/Theresienstadt zudem eine umfassende Beschreibung des Lebens im Lager vor, die nahezu alle Aspekte aus der Innensicht analysiert und dokumentiert. Anhand von Texten (sowie Bildern und Filmen) über Terezín/Theresienstadt lassen sich zentrale Aspekte kultureller Bezugnahme auf die Shoah diskutieren und analysieren. Verhandelt werden sollen Möglichkeiten, Grenzen und Tabus der Darstellung, die sogenannte Grauzone (Primo Levi), Opfer-Täter-Beziehungen, das Verhältnis von Trauma und Erinnerung und schließlich Fragen der Postmemory sowie der transnationalen und vernetzten Erinnerung an die Shoah.
Im Seminar sollen sowohl Texte gelesen werden, die im Lager Theresienstadt entstanden sind, als auch Texte, die sich ästhetisch mit dem Lager in Theresienstadt auseinandersetzen und es vergegenwärtigen (z.B. Ruth Klüger, "Weiter leben"; Arnošt Goldflam, "Sladký Theresienstadt" ("Süßes Theresienstadt"), W.G. Sebald: "Austerlitz", Jáchym Topol, "Chladnou zemí" ("Die Teufelswerkstatt"). Das Seminar ist komparatistisch angelegt und behandelt deutschsprachige sowie tschechische Texte.
Im Rahmen des Seminars findet eine Exkursion nach Prag und Theresienstadt statt.
Wintersemester 2017/2018
Doerte Bischoff: Literarische Passgeschichten (Vorlesung + Übung)
Die Vorlesung beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die Literatur vor allem des 20. und
21. Jahrhunderts die Einführung und zunehmende Bedeutung von Identitätspapieren und Pässen beobachtet und gestaltet. Eng an die Entwicklung der europäischen Nationalstaaten geknüpft, dienen Pässe der neuartigen Erfassung und Kontrolle von Menschen, deren Zugehörigkeit und Mobilität als Staatsbürger grundsätzlich geregelt wird. Autoren wie Stefan Zweig, Kurt Tucholsky oder Joseph Roth beschreiben, wie im und nach dem Ersten Weltkrieg Passregime errichtet werden, die Reisen und Migrationen auf zuvor ungekannte Weise regulieren und einschränken. Den „Wahnsinn Europa“ (Tucholsky), das in streng gegeneinander abgegrenzte Nationalstaaten zerfällt, bekommen vor allem jene von diesen ausgeschlossenen Staatenlose zu spüren, die zwischen deren Grenzen geraten und nirgends mehr Anspruch auf Zugehörigkeit und Schutz erheben können. In der Zwischenkriegszeit entsteht eine Reihe von Erzähltexten und Dramen (z.B. von B. Traven, Carl Zuckmayer oder Ödön von Horvath), die in eindrucksvollen Bildern und Konstellationen solche Formen radikaler Ausgrenzung figurieren und die in mancher Weise Analysen Hannah Arendts zur Logik der Nationalstaaten und zu den Aporien der Menschenrechte vorwegnehmen. Inwiefern, wie Arendt in ihrem 1943 im Exil entstandenen Essay „We Refugees“ beschreibt, Pässe und Geburtsurkunden gerade nach 1933 als „das soziale Mordinstrument […], mit dem man Menschen ohne Blutvergießen umbringen kann“ erscheinen, wird in der zeitgleich entstehenden Exilliteratur etwa bei Anna Seghers, Bertolt Brecht, Franz Werfel, Hans Natonek, Hans Sahl oder Erich Maria Remarque vielfältig literarisch reflektiert. Im Fokus z.B. auf Passfälschungen, fremde Papiere, prothetische und hybride Mensch-Papier-Figurationen werden jedoch auch literarische Subversionen und Transformationen bürokratischer Passregime in Szene gesetzt. Literarische Texte der Gegenwart (z.B. von Herta Müller, Vladimir Vertlib, Emine Sevgi Özdamar, Abbas Khider u.a.) greifen solche Bilder und Verfahren auf und entwickeln mit Bezug auf neuere Entwicklungen von Grenzkontrollen und Praktiken des Ausweisen (im doppelten Wortsinn) eigene Darstellungsweisen und Reflexionsformen.
Anne Benteler: Lost and found in translation: Übersetzungstheorie und Literatur (Seminar Ib)
Was passiert bei einer Übersetzung? Soll sich die Zielsprache dem Original so weit anpassen, dass sie selbst verfremdet wird? Oder kann das Original so stark verändert werden bis es der Zielsprache entspricht? Solche Fragen nach Treue und Freiheit bei der Übersetzung kennt man eigentlich aus dem Bereich der Übersetzungstheorie und -praxis. Das Seminar möchte Schnittstellen zwischen Übersetzungstheorie und Literatur in den Blick nehmen, indem übersetzungstheoretische Überlegungen seit der Romantik bis zur Gegenwart zusammen mit literarischen Texten gelesen werden, die verschiedene Formen von Übersetzung hervorbringen: z.B. Figuren als Übersetzer*innen, Selbstübersetzungen oder mehrsprachige und übersetzende Schreibweisen.
Die zu besprechenden literarischen Texte sind schwerpunktmäßig im 20. Jahrhundert und im Kontext von Exil und Migration angesiedelt. Da Übersetzungsnotwendigkeiten eine besondere Rolle im Zusammenhang von Sprach- und Kulturkontakten spielen, geht es auch um literarische Verhandlungen von „kultureller Übersetzung“.
Mögliche literarische Texte für eine gemeinsame Lektüre sind: Emine Sevgi Özdamar „Die Brücke vom Goldenen Horn“, Irena Brezna „Die undankbare Fremde“, Yoko Tawada „Überseezungen“, Werner Lansburgh „Dear Doosie“.
Sommersemester 2017
Sebastian Schirrmeister: Schlemihl, Ahasver & Co. Rastlose Gestalten in der Literatur (Seminar Ib)
Seit ihrer Entstehung im Europa der Reformation hat die christliche Legende von Ahasver, dem ‚Ewigen Juden‘, der zur Strafe für die Schmähung Jesu rastlos durch die Welt ziehen muss, unzählige literarische Bearbeitungen und interpretatorische Wandlungen erfahren. Unter anderem jüdische Autor*innen haben dazu beigetragen, dass aus der anti-jüdischen Figur ein vieldeutiger literarischer Topos und ein regelrechter Inbegriff (nicht nur) jüdischer Mobilität in der Moderne entstanden ist. In dieser Hinsicht weist der Ahasver-Mythos zahlreiche Parallelen und Verflechtungen mit der deutlich später entstandenen Figur des Schlemihl auf. Beiden literarischen Gestalten ist eine Reihe von Zuschreibungen gemein – wie etwa die rückwirkende Berufung auf biblische Figuren (Ahashverosh aus dem Buch Esther, Shlumi’el aus dem Buch Exodus), die grenzenlose Beweglichkeit in Raum und Zeit sowie die Frage, ob es sich bei dem Dasein als ewig Wandernder um Fluch oder Segen handelt.
Mit dem Schwerpunkt auf dem 19. und 20. Jahrhunderts möchte das Seminar die Wandlungs- und Transformationsprozesse der beiden teilweise ineinander übergehenden Mythen untersuchen. Dabei sind neben grundlegenden Lektüren wie Adelbert von Chamissos „Peter Schlemihls wundersamer Geschichte“ (1813) vor allem solche Texte von Interesse, die sich aktiv an der Umgestaltung und Umdeutung der Figuren beteiligen. Hierzu gehören z.B. Erzählungen, Gedichte und Romane von Heinrich Heine, Joseph Roth, Mendele M. Sforim oder Doron Rabinovici. Ergänzt werden diese durch essayistische Texte von Hannah Arendt, Vilèm Flusser sowie Jonathan und Daniel Boyarin, die vor dem Hintergrund der Nationalismen des 20. Jahrhunderts gerade ungebundene diasporische Existenzen wie sie durch Ahasver und Schlemihl repräsentiert werden, favorisieren und als Gegenmodelle stark machen.
Wintersemester 2016/2017
Doerte Bischoff: Kulturen der Dinge: Exil und Migration (Seminar II)
Die Welt, in der sich Menschen einrichten und zu Hause fühlen, wird wesentlich auch durch Gegenstände bestimmt, die sie durch täglichen Gebrauch, als Erbstücke oder besonders ‚geliebte Objekte‘ (T. Habermas) in Besitz nehmen. Was geschieht, wenn eine so konstituierte ‚Ordnung der Dinge‘ zerstört wird und/oder durch Exil und Migration in Bewegung gerät? In literarischen Texten, die Flucht, Exil und die Konfrontation mit einer zunächst fremden Umgebung verhandeln, lässt sich vielfach eine besondere Aufmerksamkeit für das Verhältnis von Menschen und Dingen beobachten. Nicht nur Jugendbücher wie Judith Kerrs „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ figurieren Ausschluss, Vertreibung und Verlust unter Bezugnahme auf privilegierte Dinge, auch in Erzählungen und Gedichten von ExilautorInnen wie Konrad Merz, Hans Sahl, Hilde Domin oder Franz Czokor treten Objekte als verlorene, aus der Ordnung gerissene und fremd gewordene besonders hervor. Indem die Dinge dabei häufig selbst zu Akteuren werden, während die Migranten und Exilierten Übersicht und Kontrolle über ihre Umwelt verlieren, werden Subjekt- und Autonomievorstellungen, die von einer grundsätzlichen Hierarchie von Mensch und Ding ausgehen, in Frage gestellt, die Be-Dingtheiten kultureller Verortung treten in den Vordergrund. Dabei werden Dinge als Immobilia nicht nur zu Reflexionsobjekten migratorischer Existenz, an ihnen zeigen sich auch Prozesse der Vermischung sowie der Um- und Mehrfachkodierung kultureller Bedeutung.
Im Zentrum der Seminardiskussionen stehen literarische Texte des 20. und 21. Jahrhunderts (neben den genannten AutorInnen werden vor allem Kafka, Nabokov, W.G. Sebald, Nicole Krauss, Edmund de Waal, Herta Müller und Jenny Erpenbeck eine Rolle spielen). Vor Seminarbeginn zu lesen sind Sebalds „Austerlitz“ und Edmund de Waals „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ (auch im engl. Original). Außerdem werden theoretische Texte zu Literatur und materieller Kultur behandelt.
Jasmin Centner: Figurationen der Rückkehr (Seminar Ib)
Geschichten von Flucht, Vertreibung, Exil und Sammellagern bestimmen aktuell neben der Tagespolitik auch die Literaturlandschaft. Konstitutiv für diese Debatte ist die Frage nach einer anschließenden Rückkehr in das Land, aus dem man geflohen ist. Historisch erfährt die literarische Auseinandersetzung mit Konstellationen der Rückkehr, Heimkehr und Remigration bereits im Kontext der Gewaltgeschichten des 20. Jahrhunderts eine beachtliche Konjunktur. Derartige Texte stehen im Zentrum dieses Seminars.
Um nachzuvollziehen, welche Funktionen intertextuelle Rückbezüge auf tradierte Erzählstränge erfüllen, wird zunächst eine historische Tiefendimension von Figurationen der Rückkehr geöffnet. Zentral dabei sind der biblische Mythos des Sündenfalls, der die Rückkehr in ein endzeitliches Paradies immer schon mitdenkt, und die paradigmatische Rückkehr der homerischen „Odyssee“.
Mit der Untersuchung von Figurationen der Rückkehr rücken Fragen nach Heimat, nationalem Ursprung und Identität ins Zentrum der Diskussion. Ist der Beginn des Exils mit dem Übertritt einer Grenze noch leicht zu datieren, richtet sich mit der Analyse von Rückkehrbewegungen der Blick auf die Dauer des Exils. Ist dieses mit einer physischen Rückkehr beendet? Wie wird die Konfrontation der Heimatimaginationen mit der vorgefundenen Realität im Zuge der Rückkehr bewertet? Bedeutet zurückkehren auch heimkehren?
Texte, die für die Lektüre in Frage kommen, sind u.a. Anna Seghers‘ „Der Ausflug der toten Mädchen“, Peter Weiss’ „Die Besiegten“ und „Meine Ortschaft“, Abbas Khiders „Brief in die Auberginenrepublik“, Barbara Honigmanns „Damals, dann und danach“, Primo Levis „Atempause“ und Auszüge aus Herta Müllers „ Atemschaukel“.
Sommersemester 2016
Doerte Bischoff: Exil und Migration in der Graphischen Literatur (Seminar II)
Comics bzw. Graphic Novels erleben seit einiger Zeit eine erstaunliche Konjunktur, was sich nicht nur in zahlreichen Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt, sondern auch in einem wachsenden Interesse der Literaturwissenschaft an diesem Genre bekundet. Dabei ist immer wieder bemerkt worden, dass Graphic Novels traditionell etablierte Grenzen programmatisch überschreiten: zwischen Bild- und Textmedien, zwischen Unterhaltung und ‚hoher‘ Literatur, zwischen verschiedenen nationalkulturell geprägten Literaturtraditionen. Übersetzung und Transfer scheinen durch den hohen Bildanteil besonders begünstigt - einige Graphic Novels wie Shaun Tans „The Arrival“ (dt. Titel „Ein neues Land“) kommen sogar ganz ohne Sprache aus. Dass hier eine nicht genau verortete, universelle Geschichte von Exil bzw. Migration erzählt wird, reflektiert auch thematisch den Übergang von einem Land zum anderen, die Begegnung mit einer zunächst fremden Umgebung. Dabei ist das Genre der Comic Bücher schon in seinen Anfängen mit Migrationsphänomenen eng verknüpft: die Erfinder von Superman & Co waren zumeist jüdische Einwanderer in die USA, auch ihre Helden kommen oft aus anderen Welten. Art Spiegelman, dessen Graphic Novel „Maus“ das Schicksal seines Vaters als Shoah-Überlebendem behandelt und damit das Genre für neue, ‚ernste‘ Themen öffnete, ist ebenfalls Migrant, was in seinen Texten auf verschiedene Weise reflektiert erscheint.
Das Seminar will diesen vielfältigen Verschränkungen von Graphic Novels mit Exil und Migration nachgehen. Auf dem Programm stehen neben „Maus“ und „Ein neues Land“ Texte, die das tragische Schicksal Exilierter thematisieren (Sorel/Seksik: „Die letzten Tage von Stefan Zweig“; Colon/Jacobson: „Anne Frank“), die autobiografischen Graphic Novels der iranischen Exilantinnen Marjane Satrapi („Persepolis“) und Parsua Bashi („Nylon Road“) sowie Texte, die aktuelle Flüchtlingsschicksale in Europa behandeln: Paula Bulling: „Im Land der Frühaufsteher“; Ville Tietäväinen: „Unsichtbare Hände“; Reinhard Kleist: „Der Traum von Olympia“.
Das Seminar ist eingebunden in die Hamburger „Tage des Exils“ – es wird Gastvorträge, eine Ausstellung und einen Workshop mit Andreas Platthaus (FAZ) geben. Thematisch ist es außerdem verbunden mit einer Nummer des „Exilographen“ (Newsletter der Exil-Forschungsstelle), zu dem ggf. Beiträge verfasst werden können.
Wintersemester 2015/2016
Doerte Bischoff: „Exil und Shoah“ (Seminar II)
Das Seminar widmet sich der Frage, inwiefern und auf welche Weise in der deutschsprachigen Literatur, die das Exil aus Nazideutschland bezeugt, die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden verhandelt wird. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf dem bloßen Befund solcher thematischen Gestaltung, gefragt werden soll vor allem, inwiefern jeweils spezifische Verknüpfungen zwischen der Exilsituation und der Shoah hergestellt werden – etwa in einer besonderen Akzentuierung von Zeugenschaft und Zeitgenossenschaft, in Reflexionen auf das Exil als Existenzweise des Überlebens oder in einer Hinwendung zu religiösen und kulturellen Deutungsmustern des Exils, welche dieses Formen der kulturellen Verortung gegenüberstellen, wie sie etwa die Assimilationsversprechen der europäischen Nationalstaaten implizierten, die nun vielfach als gescheitert erklärt werden. Entgegen einer ersten Intuition, welche Exil und Shoah zumindest aus heutiger Perspektive als eng miteinander verbunden wahrnimmt, hat dieser Komplex in der Forschung bislang kaum Beachtung gefunden, was mit der starken Fokussierung politischer und häufig auch nationaler Orientierungen des Exils (als dem ‚anderen Deutschland‘) in der älteren Exilforschung zu tun hat.
Zu den Seminarlektüren gehören ausdrückliche Äußerungen von Exilanten zur nationalsozialistischen Judenverfolgung (wie der Reichspogromnacht), frühe Reaktionen auf die Nachrichten von den Vernichtungslagern im Exil (etwa bei Adorno, Hannah Arendt oder Hermann Broch) sowie Texte unterschiedlicher Entstehungszeit, die das Verhältnis von Exil und Shoah reflektieren: z.B. Ferdinand Bruckner: Die Rassen; Joseph Roth: Tarabas; Franz Werfel: Jacobowsky und der Oberst; H.W. Katz: Die Fischmanns; Stefan Zweig: Der begrabene Leuchter; Soma Morgenstern: Funken im Abgrund; Jean Améry: Wieviel Heimat braucht der Mensch?; Peter Weiss: Fluchtpunkt; Gedichte von Nelly Sachs und Karl Wolfskehl sowie postexilische Texte von W.G. Sebald, Barbara Honigmann und Doron Rabinovici.
Doerte Bischoff: „Literatur und Lager“ (Seminar II)
In philosophischen und kulturtheoretischen Reflexionen über die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts wie über die Shoah nimmt das Lager eine zentrale Position ein. Es erscheint als Paradigma der Moderne, als Ort, an dem die Durchrationalisierung der Gesellschaft im Extrem erscheint, als biopolitisches Paradigma, das einen totalisierenden Zugriff auf das menschliche Leben realisiert, als Verräumlichung des Ausnahmezustands u.a. Einige zentrale theoretische Texte von Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Zygmunt Bauman und Wolfgang Sofsky sollen im Seminar (ggf. in Auszügen) vorgestellt und diskutiert werden, wobei auch die Notwendigkeit einer kritischen Differenzierung des Begriffs (z.B. als Sammellager, Konzentrationslager, Vernichtungslager) Berücksichtigung finden wird. Die Auswahl der gemeinsam zu lesenden Literatur umfasst zum einen europäische Schlüsseltexte (ggf. in Ausschnitten), die Lagererfahrungen dokumentieren und literarisch gestalten (z.B. von Primo Levi, Robert Antelme, Imre Kertész, Tadeusz Borowski, Warlam Schalamov,) und die als Bezugs- und Intertexte deutschsprachiger Lagerliteratur vielfach bedeutsam sind. Diskutiert werden sollen hier sowohl Berichte und Literarisierungen von Überlebenden wie auch postmemoriale Gestaltungen z.B. bei Hermann Langbein („Menschen in Auschwitz“), Jean Améry („Jenseits von Gut und Böse“), Bruno Apitz („Nackt unter Wölfen“), Jurek Becker („Jakob der Lügner“), George Tabori („Die Kannibalen“), Fred Wander („Der siebente Brunnen“), Peter Weiss („Meine Ortschaft“), Ruth Klüger („weiter leben“) Herta Müller („Atemschaukel“) sowie Franz Kafka („In der Strafkolonie“).
Sommersemester 2015
Doerte Bischoff: „Autobiografie und Exil“ (Seminar II + Übung)
Die Erfahrung von Vertreibung und Exil nach 1933 wird in einer bemerkenswert großen Zahl von autobiografischen Texten bezeugt. Die oft traumatischen Erschütterungen, die mit Ausgrenzung, Entortung sowie existentiellen Verlusten einhergehen, aber auch die vielfältigen Herausforderungen durch die Konfrontation mit fremden Ländern, Sprachen und Kulturen sind offenkundig Auslöser für vielfältige Schreibprojekte, die darauf zielen, zerbrochene Gewissheiten und Identitäten vorzuführen, Brüche und Verletzungen aber auch zu überwinden und zu heilen. Charakteristisch für das Schreiben des Lebens unter Extrembedingungen ist häufig die Tendenz, dass Grenzen zwischen Dokumentarischem und Fiktionalisierung, zwischen Autobiografie und Roman undeutlich werden: erscheint das Geschichtenerzählen, die Konstruktion imaginärer Kohärenz einer Lebensgeschichte, einerseits überlebenswichtig, so drängen sich zugleich die extremen Erlebnisse der Exilrealität oft als kaum distanzierbare oder ästhetisch transformierbare auf. Als nicht immer zu ordnende oder deutbare Momente einschneidender Erfahrung bleiben sie oft auch lange Zeit später, selbst für nachfolgende Generationen mit dem Appell verknüpft, extremes Geschehen und traumatisches Erleben in der Sprache bzw. im kulturellen Gedächtnis zu bergen.
Im Seminar soll ein größeres Spektrum von Texten gelesen werden, die entweder im unmittelbaren Eindruck der historischen Ereignisse, in der z. T. Jahrzehnte später formulierten Rückschau auf diese oder aber in einer Art stellvertretender Sammlung und Präsentation autobiografischer Zeugnisse entstehen. Neben einer Reihe kanonischer Texte der ‚klassischen' Exilepoche (z.B. Stefan Zweig: Die Welt von gestern; Heinrich Mann: Ein Zeitalter wird besichtigt; Carl Zuckmayer: Als wär's ein Stück von mir; Klaus Mann: Der Wendepunkt), die z. T. in Ausschnitten gelesen werden, stehen auch Texte, die an der Schwelle zwischen Fiktion und Autobiografie angesiedelt sind, auf dem Programm (Hans Sahl: Die Wenigen und die Vielen; Peter Weiss: Fluchtpunkt; Anna Seghers: Der Ausflug der toten Mädchen; Konrad Merz: Ein Mensch fällt aus Deutschland; Hilde Domin: Unter Akrobaten und Vögeln). Mit Ursula Krechels Shanghai fern von wo und Abbas Khiders Der falsche Inder werden außerdem neuere literarische Texte diskutiert, die demonstrieren, dass die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Exilbiografien auf verschiedene Weise auch die Gegenwartsliteratur prägt.
Die Lektüren werden durch eine Auseinandersetzung mit theoretischen Texten zu Autorschaft, Autobiografie und Autofiktion im Horizont von Exil und Migration begleitet. Das Seminar findet in enger Kooperation mit einer ähnlichen Lehrveranstaltung in Frankfurt/Main (unter der Leitung von Susanne Komfort-Hein) statt.
Doerte Bischoff: „Transnationalität und Literatur“ (Vorlesung)
Seit dem 19. Jahrhundert ist die deutschsprachige Literatur vor allem als Nationalliteratur wahrgenommen worden, woran die in dieser Zeit entstehende Germanistik, die sich im Horizont der noch jungen Nationalstaaten entwickelt, an deren Etablierung sie zugleich mitwirkt, keinen geringen Anteil hat. Wenn heute in der literarischen Öffentlichkeit, aber auch in der Literaturwissenschaft den immer zahlreicheren Autoren und Autorinnen ein gesteigertes Interesse entgegen gebracht wird, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, deren Geburtsort andernorts sich befindet und deren Texte kulturelle Vielstimmigkeit, Sprachwechsel und Mehrfachloyalitäten zentral verhandeln, ist offenbar eine Verschiebung zu beobachten, die das nationale Paradigma für die Produktion und Rezeption von Literatur grundsätzlich in Frage stellt. Dabei werden nicht nur die historischen Erscheinungsformen und strukturellen Implikationen einer als national wahrgenommenen Literatur auf neue Weise zum Gegenstand der Untersuchung und kritischen Reflexion, es treten auch lange marginalisierte Formen literarischer Transnationalität in den Fokus der Analysen. Die Vorlesung rekonstruiert historische Bedingungen und Rhetoriken, die eine Nationalliteratur haben entstehen lassen und stellt Beispiele von Texten unterschiedlicher Epochen bis zur Gegenwart vor, die diese durch explizit transnationale Bezüge und Vernetzungen unterlaufen. Konzepte der Weltliteratur und des literarischen Kosmopolitismus, so wird zu zeigen sein, prägen sich in verschiedenen historischen Konstellationen – z.B. auch im Horizont von Exil und Migration nach 1933 – mit unterschiedlichen Akzenten heraus und lassen doch auch Parallelen und Anschlüsse für gegenwärtige Debatten über Literatur im globalen Zeitalter erkennen. Insgesamt soll in der Auseinandersetzung mit verwandten kulturtheoretischen Konzepten wie Transkulturalität, Translokalität und Diaspora, Hybridität, Übersetzung (translational turn) und mehrdirektionaler Erinnerung das in den Literaturwissenschaften noch relativ neue Paradigma der Transnationalität profiliert werden.
Wintersemester 2013/2014
Doerte Bischoff: „Exil aktuell: Verhandlungen in der Literatur der Gegenwart“ (Seminar II)
Als Herta Müller 2011 in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin die Einrichtung eines „Museums des Exils“ forderte, zeichnete sich bereits eine Erneuerung des öffentlichen und wissenschaftlichen Interesses für die Geschichte(n) von Ausgrenzung und Exil in der (nicht nur) deutschen Vergangenheit ab. Nun hat der Impuls der Nobelpreisträgerin verschiedenen Initiativen, welche die historischen, politischen und diskursgeschichtlichen Bedingungen des Exils reflektieren und präsentieren, weitere Impulse gegeben, wie das vom Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt (Main) und vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach initiierte virtuelle Museum „Künste des Exils“, aber auch eine Reihe aktueller Ausstellungen demonstrieren. Auch in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gibt es bemerkenswert zahlreiche Tendenzen, das Thema Exil auf neue Weise ins Zentrum zu rücken. Zum einen wird in einer Reihe von Erzähltexten ausdrücklich auf das Exil aus Nazi-Deutschland 1933-1945 Bezug genommen, werden berühmte und weniger bekannte historische, aber auch fiktive ExilantInnen literarisch zum Leben erweckt. Wenn etwa Thomas Hettche in Woraus wir gemacht sind (2006) seinen Protagonisten auf den Spuren eines jüdischen Emigranten nach New York schickt, Michael Lentz in Pazifik Exil (2007) den Weg von Heinrich und Thomas Mann, Franz Werfel und Bertolt Brecht ins kalifornische Exil literarisch nachzeichnet, Ursula Krechel in Shanghai fern von wo (2008) weniger bekannten Exilanten in Shanghai eine Stimme gibt, Hans Joachim Schädlich in Kokoschkins Reise (2010) einen jüdischen Amerikaner am Ende des Jahrhunderts auf sein von mehrfachen Exilierungen geprägtes Leben zurückblicken lässt, wenn Klaus Modick in Sunset (2011) Lion Feuchtwanger in seinem us-amerikanischen Exil über sein Verhältnis zu Bertolt Brecht nachsinnen lässt oder Norbert Gstrein in Die englischen Jahre eines jüdisch-österreichischen Emigranten während des Zweiten Weltkrieg nachzeichnet, stellt sich die Frage, wie eine solche Konjunktur des Exil-Themas erklärt und beschrieben werden kann.
Diskutiert werden soll, inwiefern das neu erwachende Interesse ein Indiz dafür sein könnte, dass sich im Bezug auf das (historische) Exil Fragen und Konstellationen der Gegenwart besonders pointiert reflektieren lassen und welche Textverfahren sich in dieser Erinnerungskultur ausprägen. Aufschlussreich sind hier auch solche Texte, in denen gegenwärtige Konstellationen von Exil, Migration und Globalisierung mit Erinnerungen an ein historisches Exil verschränkt werden (z.B. in Zafer Senocaks Gefährliche Verwandtschaft, Barbara Honigmanns Alles, alles Liebe!, Doron Rabinovicis Andernorts).
Das Seminar wird diese Fragen anhand ausgewählter Lektüren diskutieren, die auch Texte von in Deutschland lebenden ExilautorInnen einschließen sollen (z.B. Abbas Khider: Briefe in die Auberginenrepublik; Hamid Skif: Geografie der Angst), womit der Bezug auf aktuelle Exile ausgeweitet wird. Es steht damit im Zusammenhang mit Veranstaltungen der Berendsohn Forschungsstelle für deutsche Exilliteratur im Wintersemester, in denen Lesungen von und Gespräche mit AutorInnen im Vordergrund stehen, für die Deutschland Exilland ist.
Doerte Bischoff, Esther Kilchmann: „Literatur und Exil: Konstellationen, Theorien, Lektüren“ (Seminar II + Übung)
Exiliert zu sein, bedeutet in den meisten Fällen auch, abgetrennt zu sein von der Sprachgemeinschaft, in der man sich beheimatet gefühlt hatte. Gerade Autorinnen und Autoren, die während des historischen Exils aus Nazi-Deutschland in zahlreiche Länder und (Fremd-)Sprachen verschlagen waren, haben den Verlust der ‚Muttersprache‘, die auch die Sprache ihre Dichtungen war, vielfach als existentielle Beraubung beklagt. Wie ein Musiker, der „auf einer Geige aus Stein, auf einem Klavier ohne Saiten“ spiele, sei der Dichter im Exil, so hat es etwa Leonhard Frank formuliert. Auch in Gegenwartstexten, die Exil- und Migrationserfahrungen verhandeln, spielt die Frage nach der Bedeutung der ‚Muttersprache‘ und der Konfrontation mit der zunächst oft fremden Sprache des Exillandes eine zentrale Rolle. Allerdings werden hier zunehmend auch produktive Aspekte von Sprachwechsel, Mehrsprachigkeit und Sprachmischung ausdrücklich thematisiert. Das Seminar erkundet dieses Spannungsverhältnis, das bei genauerer Betrachtung auch bereits in vielen (oft den weniger kanonisierten) historischen Texten artikuliert wird. Hiervon ausgehend sollen diskursgeschichtliche Konstruktionen von Muttersprache und Einsprachigkeit, Nationalsprache und Sprachreinheit diskutiert werden. Es soll danach gefragt werden, inwiefern literarische Texte des Exils und der Migration solche Konzepte kultureller und sprachlicher Verwurzelung nicht nur aktualisieren, sondern auch problematisieren und auf welche Weise etwa ein Leben und Schreiben ‚zwischen den Sprachen‘ (Améry) mit kritischen und innovativen Impulse verbunden wird.
Neben Texten, die das Exil 1933-45 reflektieren (z. B. Mascha Kaléko, Michael Hamburger, Ludwig Strauss, Konrad Merz, Oskar Maria Graf, Hans Keilson, Werner Lansburgh), stehen neuere Texte der gegenwärtigen Migrationsliteratur (z. B. Emine Sevgi Özdamar) sowie W.G. Sebalds auf dem Programm. Hinzu kommen poetologische Texte, in denen die Autorinnen und Autoren beider Gruppen über die Erfahrung von Exil und Migration und deren Auswirkung auf ihre Literatursprache nachdenken (etwa Essays von Lion Feuchtwanger, Schalom Ben-Chorin, Jean Améry, Peter Weiss, G. A. Goldschmidt). Schließlich soll das Thema auch aus sprachphilosophischer und kulturtheoretischer Perspektive in den Blick genommen werden. Gelesen werden grundlegende Texte zu den sich um 1800 etablierenden Konzepten von „Muttersprache“ und „Nationalsprache“ (Schleiermacher, Fichte) sowie neuere psychoanalytische und philosophische Untersuchungen zum Zusammenhang von Einsprachigkeit, Sprachwechsel und Identität wie Jacques Derridas „Die Einsprachigkeit des Anderen“.
Sommersemester 2012
Doerte Bischoff : „Literatur und Exil: Konstellationen, Theorien, Lektüren“ (Vorlesung)
Mit dem Begriff „Exilliteratur“ wird in germanistischen Kontexten bis heute die literarische Produktion jener AutorInnen bezeichnet, die 1933-45 aus Nazideutschland flohen. Die Vorlesung stellt eine Reihe dieser Texte (Lyrik, Prosa, Dramen) im historischen Kontext vor, weitet die Perspektive auf Konstellationen von Literatur und Exil aber zugleich aus, indem über die „klassische Exilepoche“ hinausgehend auch Texte des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart einbezogen werden. Eine Leitfrage ist dabei, inwiefern Literatur, die von Ausgrenzung, Heimatverlust und Entortung Zeugnis ablegt, alternative Identitätsentwürfe und ästhetische Verfahren entwickelt, die homogenisierende Herkunfts- und Geschichtserzählungen unterlaufen und problematisieren. Gerade historische Texte, die jenseits einer konkreten historischen Referenz eine Spannung aufrechterhalten zwischen singulärem traumatischem Ereignis und orientierenden Geschichts- und Gemeinschaftskonstruktionen sind, so die These, anschlussfähig für nach 1945 bzw. gegenwärtig entstehende Literatur, die vor dem Horizont des Zivilisationsbruchs der Shoah einerseits, im Kontext transkultureller Lebens- und Schreibweisen andererseits Brüche, Widersprüche und den Entzug eindeutiger Verortungen thematisiert. Diskutiert werden soll dabei auch, inwiefern gerade jüdische Traditionen von Exil und Diaspora zitiert und reaktualisiert werden.
Behandelt werden sollen Texte von Heinrich Heine, aus dem Umfeld der „Ghettoliteratur“, von Joseph Roth, Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Franz Werfel, Anna Seghers, Bertolt Brecht, Hilde Domin, Else Lasker-Schüler, Mascha Kaleko, Hermann Broch, Thomas Mann, Oscar Maria Graf, Hilde Spiel, Peter Weiss, Herta Müller, Barbara Honigmann, Doron Rabinovici, Irena Vrkljan, Julya Rabinowich, Zafer Senocak, Aris Fioretos u.a. Theoretische Bezüge werden hergestellt zu psychoanalytischer Traumatheorie, zu poststruktualistischer Differenztheorie und Postkolonialismus, zur neueren Autobiografie- und Autofiktionsforschung sowie zu Entwürfen von Transkulturalität und Transnationalität.
Claudia Röser: „Europa im Exil. Figurationen des Europäischen in der Exilliteratur“ (Seminar Ib)
Der Gründungsmythos Europas erzählt eine Geschichte vom Exil: Europas mythische Namensgeberin, die Königstochter Europa wurde vom in einen Stier verwandelten Zeus an den Küsten Asiens geraubt und nach Europa gebracht, wo sie ihm Kinder gebar. Figurationen des Europäischen verbinden sich demnach von Beginn an mit der Erfahrung des Exils, dem erzwungenen Verlust von Heimat. Das Exil jedoch erlangt für die Literatur der in den Jahren 1933-1945 aus Deutschland geflohenen Schriftsteller und Schriftstellerinnen eine ganz besondere Qualität. Flucht, Herausgerissensein aus den gewohnten kulturellen, sozialen und ökonomischen Zusammenhängen, die Begegnung mit anderen Kulturen bedingt eine Auseinandersetzung mit dem ‚Eigenen‘. Die Forschung hat sich lange Zeit an den von exilierten Schriftstellern und Schriftstellerinnen formulierten Anspruch gehalten, ein ‚anderes Deutschland‘, das eigentliche, wahre Deutschland zu repräsentieren. Die neue Perspektive lässt jedoch zugleich den Kontinent in den Blick geraten: Diesen Vorstellungen von Europa, diesen Konzeptionen des Europäischen möchte das Seminar nachgehen. Wo werden Figurationen des Europäischen entworfen? Was für ein Europa konstruieren sie? Welche Funktionen haben diese Figurationen für die literarischen Texte, das Schreiben der Exilschriftsteller und -schriftstellerinnen? Wie setzen sich traumatische Erfahrungen des Exils und Erfahrungen im Gastland zu Europa ins Verhältnis? Inwiefern verbinden sich Figurationen des Europäischen mit transkulturellen Erfahrungen und wie verknüpfen sich Poetiken des Exils mit denen des Europäischen?
Diese Fragen sollen an literarischen Texten wie Hilde Spiels Lisas Zimmer, Anna Seghers Transit, Lion Feuchtwangers Venedig (Texas), Essays der Brüder Heinrich und Thomas Mann sowie an einem literaturtheoretischen Text des Exils, nämlich Erich Auerbachs Mimesis, untersucht werden.
Sebastian Schirrmeister: „Exil im Land der Väter? Deutschsprachige Literatur aus Palästina/Israel“ (Seminar Ib)
Heimat ist anderswo heißt eine der Anthologien, die Erzählungen und Gedichte deutschsprachiger Autorinnen und Autoren aus Israel versammelt. Unter diesem Blickwinkel, der bereits auf die Unmöglichkeit der eindeutigen nationalen Zuordnung verweist, sollen im Seminar deutschsprachige Texte betrachtet werden, die sich im Spannungsfeld zwischen dem zionistischen Narrativ der „Heimkehr des jüdischen Volkes“ ins Land der Väter und der Erfahrung von Exil und Vertreibung aus Deutschland und dem deutschen Sprachraum bewegen. Neben der Auseinandersetzung mit der deutschen Muttersprache und der hebräischen „Sprache der Väter“ sowie der bewussten Entscheidung, trotz oder gerade aufgrund der Exilerfahrung in Israel auf Deutsch zu schreiben, werden ausgewählte Texte auf alternative Gemeinschaftskonzepte (Diaspora, Transnationalität) hin untersucht. Ein dritter Schwerpunkt soll zudem auf der Frage liegen, inwiefern die Texte auf eine literarische Tradition der jüdischen Exilerfahrung Bezug nehmen.
Die Auswahl umfasst u.a. Texte von Moshe Yaakov Ben-Gavriël (Eugen Hoeflich), Max Brod, Else Lasker-Schüler, Jenny Aloni, Sammy Gronemann, Anna-Maria Jokl und Doron Rabinovici.
Doerte Bischoff: „Transnationalität: literarische und theoretische Entwürfe“ (Seminar II)
Migration, Globalisierung und deterritoriale digitale Netzwerke prägen nicht nur soziale, politische und ökonomische Strukturen heutiger Gesellschaften, sie haben auch einen erheblichen Einfluss auf Produktions- und Rezeptionskontexte von Literatur, auf Motive und Schreibweisen literarischer Texte sowie auf das Selbstverständnis der literaturwissenschaftlichen Disziplinen. Literatur, die sich zwischen den Kulturen ansiedelt, die Phänomene kultureller Entgrenzung, Übersetzung und Hybridisierung, von Exophonie und Translingualität prominent verhandelt und produktiv werden lässt, lässt sich nicht mehr ohne Weiteres im 'Container' der klassischen Nationalphilologien verorten. Im Seminar sollen zunächst Texte gelesen werden, welche die Verschränkung von Nationaldiskurs und Literatur(wissenschaft) zu Beginn des 19. Jahrhunderts besonders eindrücklich dokumentieren, indem sie sie entweder affirmieren (Herder, E.M. Arndt) oder auf unterschiedliche Weise transformieren (Goethe, Heine). Angesichts des inzwischen vielfach reflektierten Befundes, dass die Vorstellung von der Nation als einheitliche und abgrenzbare kulturelle Größe als imaginäre Setzung (B. Anderson) zu beschreiben ist, die narrativ erzeugt wird (H. Bhabha), soll dann eine Auswahl literarischer Texte diskutiert werden, welche diese nationalen Narrative unterlaufen und ihre Grenzsetzungen zur Disposition stellen.
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der jüdisch geprägten Prager deutschen Literatur (Kafka, Werfel, Brod, Reinerova u.a.), ein anderer auf der Literatur der Gegenwart (z.B. B. Honigmann, V. Vertlib, D. Dinev, E. Özdamar, T. Mora, Z. Senocak, A. Fioretos). Im Vergleich der Texte und im Bezug auf aktuelle Diskussionen um Post- bzw. Transnationalität sollen schließlich verschiedene Modelle literarisch inszenierter Transnationalität differenziert werden.
Doerte Bischoff: „Heinrich Heine: Schreiben an den Grenzen des Nationalen“ (Seminar II)
Was ist ein deutscher Dichter? Diese Frage hat die um 1835 entstehende deutsche Literaturgeschichtsschreibung ebenso interessiert wie viele Zeitgenossen. Denn in der politischen Umbruchssituation nach der französischen Revolution und der Napoleonischen Neuordnung Europas kristallisierte sich die Frage nach einer auch politisch eigenständigen deutschen Nation zunächst an Entwürfen deutscher Literatur und Geistigkeit. Noch heute ist die Vorstellung von Deutschland als „Kulturnation“ in mancher Weise präsent und wirkmächtig. Ein Blick zurück auf die Literatur der Befreiungskriege zeigt die problematischen Implikationen, wenn das vielfach beschworene Nationale in Abgrenzung gegen das vermeintlich Fremde in Gestalt des Französischen, Europäischen, Internationalen konstruiert wird. Dagegen öffnet die Auseinandersetzung mit den Schriften des Zeitgenossen Heine, die Nationales stets im Austausch und Bezug auf diese entwerfen und problematisieren, einen anderen Blick auf das Verhältnis von Kultur und Nation wie auch von Poesie und Politik. Als sozialkritischer Denker, als (später getaufter) Jude, als Frankophiler und Frankreich-Emigrant war Heine ein Randgänger, der immer wieder den Konsens der Nationalen störte, gerade indem er sich als prominente Stimme im nationalen Diskurs und zugleich als „inkarnierter Kosmopolitismus“ behauptete. Seine literarischen Reiseberichte legen nicht nur von der eigenen Beweglichkeit Zeugnis ab, sondern vor allem von der Beweglichkeit poetischer Sprache, deren Ironie und Vielstimmigkeit jeder ideologischen Grenzsetzung den Boden entzieht. Dabei lässt sich Heine nicht einfach als Fürsprecher und Repräsentant eines „anderen Deutschland“ in Dienst nehmen, vielmehr entwerfen seine Texte, in denen sich deutsche, französische und jüdische Identität nicht ausschließen und mit dem „portativen Vaterland“ diasporische und exilische Existenzweisen erkundet werden, Gemeinschaft jenseits nationaler Fixierung und Verortung.
Gerade heute, wo die einen die Frage nach einer deutschen Leitkultur aufs Neue stellen, während die anderen transkulturelle Lebensläufe und Schreibweisen als typischen Ausdruck aktueller deutschsprachiger Literatur sehen, ist eine Beschäftigung mit Heines Texten von besonderer Aktualität. Gegenstand des Seminars ist eine Auswahl von Heines poetischen, essayistischen, kulturphilosophischen und politischen Schriften, die sich als solche gerade im Blick auf die Frage der (De-)Konstruktionen des Nationalen kaum gegeneinander abgrenzen lassen.
Doerte Bischoff, Claudia Zenk: „Doktor Faustus: Thomas Manns Exil-Roman über die Musik im 20. Jahrhundert“ (Seminar II)
Während seines Exils in den USA schrieb Thomas 1943 bis 1947 an einem monumentalen Roman, der Totalitarismuskritik und Analyse des deutschen Faschismus ist, zugleich aber auch als Künstlerroman gelesen werden kann: Im Zentrum des Doktor Faustus steht das Leben und Schicksal des „deutschen Tonsetzers“ Adrian Leverkühn, das eng mit dem deutschen Weg in die Katastrophe des Nationalsozialismus verknüpft wird. Mit dieser Engführung erteilt der Roman der bürgerlichen Vorstellung eine Absage, Politik und Kunst bzw. Kultur seien abgelöst voneinander wahrnehmbar und verhandelbar. Auch der in linken Exilkreisen lange vorherrschende Gedanke, die Besinnung auf eine deutsche Kulturtradition, die von den Nazis pervertiert und zu Unrecht usurpiert werde, sei als solche geeignet, dem Faschismus Widerstand entgegenzusetzen, erscheint hier konsequent in Frage gestellt. Stattdessen lenkt der Text durch vielfältige Rückblicke, Exkurse und Zitatmontagen den Blick auf komplexe kulturgeschichtliche Konstellationen seit dem Mittelalter und der Reformation, in denen Politikabstinenz und chauvinistische Selbsterhebung, Weltferne und der Kult einer angeblich überlegenen Geistigkeit sich wechselseitig bedingen und fatale Effekte und Entwicklungen hervorrufen. Die Musik wird dabei als die „deutscheste“ aller Kunstformen beschrieben, deren Entwicklung im 20. Jahrhundert hier in besonderer Weise nicht nur Charakteristika der Kunst unter den Bedingungen der Moderne allgemein erkennen lässt, sondern die auch zu der politischen Entwicklung in besonderer Korrespondenz und Nähe steht. So wird die Tendenz zur Abstraktion und Artifizialität, wie sie sich in der von Arnold Schönberg entwickelten Zwölftonmusik (die im Roman Leverkühn zugeschrieben wird) manifestiert, im Kontext einer insgesamt als problematisch gekennzeichneten Entsinnlichung beschrieben, an dessen Endpunkt künstlerische Inspiration und Schöpfung nur mehr durch einen Pakt mit dem Teufel zu erreichen ist, der gleichzeitig modern und antimodern ist.
Im Seminar sollen die musikalischen Referenzen im Roman (Beethoven, Wagner, Pfitzner, Schönberg u.a.) sowie die z.T. sehr ausführlichen musiktheoretischen Erörterungen mit Bezug auf wichtige Referenztexte (bes. Nietzsche und Adorno) nachvollzogen und diskutiert werden. Dabei soll auch nach dem Musikleben im München der 1920er Jahre sowie dem Verhältnis von Musik und Nationalismus und gefragt werden. Die literarische Beschreibung der Kompositionen Leverkühns zu behandeln, schließt musik- wie literaturwissenschaftliche Perspektiven ein, öffnet den Blick aber darüber hinaus für Fragen der Intermedialität, insofern das Verhältnis von Sprache und Musik grundsätzlich zur Diskussion gestellt wird.
Wintersemester 2011/2012
„Exil - Literatur - Judentum“ (Ringvorlesung)
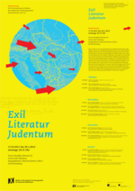 Mit der Flucht vor der nationalsozialistischen Verfolgung stellte sich für viele jüdische Literaten und Intellektuelle die Frage danach, ob eine deutsch-jüdische Symbiose jemals mehr als eine Wunschphantasie gewesen war. Für viele wurden mit der Assimilation an die deutsche Kultur dabei zugleich auch die für die jüdische Moderne prägenden Konzepte von Assimilation und Akkulturation als solche fragwürdig. Wo nicht eine Hinwendung zum Zionismus die Konsequenz war, lässt sich jenseits religiöser Orientierung häufig eine verstärkte Auseinandersetzung mit jüdischen Traditionen von Diaspora und Galut (Exil) beobachten. Gegen die Idee einer nationalstaatlichen Verwurzelung und Identifizierung behauptet diese Tradition Exil nicht als Gegenbegriff zu Heimat, sondern als eine besondere Kondition, in welcher das Ankommen, das Sich-Verorten zugunsten einer Prozessualität und Medialität von Identitätsentwürfen auf Distanz gehalten erscheint (z.B. im emphatischen Bezug auf Buch und Text, Schrift und Schriftauslegung).
Mit der Flucht vor der nationalsozialistischen Verfolgung stellte sich für viele jüdische Literaten und Intellektuelle die Frage danach, ob eine deutsch-jüdische Symbiose jemals mehr als eine Wunschphantasie gewesen war. Für viele wurden mit der Assimilation an die deutsche Kultur dabei zugleich auch die für die jüdische Moderne prägenden Konzepte von Assimilation und Akkulturation als solche fragwürdig. Wo nicht eine Hinwendung zum Zionismus die Konsequenz war, lässt sich jenseits religiöser Orientierung häufig eine verstärkte Auseinandersetzung mit jüdischen Traditionen von Diaspora und Galut (Exil) beobachten. Gegen die Idee einer nationalstaatlichen Verwurzelung und Identifizierung behauptet diese Tradition Exil nicht als Gegenbegriff zu Heimat, sondern als eine besondere Kondition, in welcher das Ankommen, das Sich-Verorten zugunsten einer Prozessualität und Medialität von Identitätsentwürfen auf Distanz gehalten erscheint (z.B. im emphatischen Bezug auf Buch und Text, Schrift und Schriftauslegung).
Bereits 1943 hat Hannah Arendt in einem Essay mit dem Titel „Wir Flüchtlinge“ („We Refugees“) darauf hingewiesen, dass der Flüchtlingsstatus und die ungeschützte Situation als Staatenlose im Zeitalter des Totalitarismus und der Massenvertreibungen kein spezifisch jüdisches Problem mehr sei: „Zum ersten Mal gibt es keine separate jüdische Geschichte mehr; sie ist verknüpft mit der Geschichte aller anderen Nationen.“ Am Beginn des 21. Jahrhunderts, in dem die Erfahrung der Vertreibung, Exilierung und der Migrationen von immer mehr Menschen geteilt wird und sich die Frage nach dem Verhältnis von Heimat und Exil auf vielfältige Weise neu stellt, spielt die Auseinandersetzung mit dieser Einsicht ebenso wie mit jüdischer Erfahrung und Tradition des Exils eine wichtige Rolle. Indem die Ringvorlesung „Exil - Literatur - Judentum“ eine Konstellation in den Blick rückt, deren drei Aspekte unterschiedlich akzentuiert und verknüpft werden können, will sie zu einer Auseinandersetzung mit diesen ebenso geschichtsträchtigen wie aktuellen Fragen einladen. (Programm der Ringvorlesung)
Doerte Bischoff, Sebastian Schirrmeister: „Fluchtpunkt USA. Amerika in der Literatur - Literaten in Amerika“ (Seminar Ib)
„Amerika, du hast es besser / als unser Kontinent, der alte“, dichtet Goethe 1827 wohl nicht ganz ohne Ironie, indem Amerika als Gegenbild zu Europa und Projektionsfläche europäischer Imaginationen reflektiert wird. In seinen Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten und in den "Wanderjahren ist Amerika als Zufluchts- und Zukunftsort gestaltet, mit dem sich nicht nur Träume und Wünsche, sondern auch Ängste verknüpfen. Das Seminar schlägt einen Bogen von Amerikatexten des 19. Jahrhunderts, in denen die neue Welt entweder als Zerr- und Schreckbild des Eigenen verteufelt (Kürnberger Der Amerikamüde) oder im Gefolge von Reisen und Auswandererunternehmungen als potentielle Alternative zu Europa entdeckt wird (Sealsfield Die Vereinigten Staaten von Amerika) über Amerikaromane der Moderne und der Exilzeit bis hin zur Gegenwartsliteratur. Während Kafka seinen Amerikaroman (Der Verschollene) noch ganz ohne eigene Anschauung schrieb, wurden die USA für viele NS-Flüchtlinge zu einer realen Lebenshoffnung und für eine große Zahl für Jahre, wenn nicht dauerhaft zu einem neuen Lebensort, für manche zur neuen Heimat. Dabei stellt sich die Frage, wie das Exil gerade in dem klassischen Einwanderungsland wahrgenommen und reflektiert wurde und wie klassische Amerika-Bilder und -Topoi in der Exilliteratur und z.T. in der Annäherung an das Hollywood-Kino (um-)gestaltet werden. Aufschlussreich ist hier auch die Geschichte der deutsch-jüdischen Zeitschrift Aufbau, die, als Emigrantenzeitschrift gegründet, vielen exilierten AutorInnen und Intellektuellen ein Forum bot.
Im Einzelnen untersucht werden sollten neben Gedichten von Mascha Kaleko, Hans Sahl und Yvan Goll Texte und Textausschnitte z.B. von Klaus Mann (Der Vulkan, Der Wendepunkt), Lion Feuchtwanger (z.B. Die Füchse des Weinbergs), Oskar Maria Graf (Die Flucht ins Mittelmäßige), Thomas Mann (Josephsromane), Karl Jakob Hirsch (Manhattan Serenade), Frederic Morton (Crosstown Sabbath. Über den Zwang zur Unrast) sowie Hilde Spiel (Lisas Zimmer). Ein Blick auf neuere Amerika-Texte, die das historische Exil wiederaufgreifen und zugleich die Frage nach dem Verhältnis von Exil, Emigration und nationaler bzw. kultureller Zugehörigkeit neu stellen, soll das Seminar beschließen (z.B. Wolfgang Koeppen Amerikafahrt, Gerd Fuchs Die Auswanderer, Michael Lentz Pazifik Exil, Hans Joachim Schädlich Kokoschkins Reise, Klaus Modick Sunset).
Doerte Bischoff, Sebastian Schirrmeister: „Exil in den USA 1933-1945: Fallstudien und Dokumentation“ (Projektseminar Ib)
Das Projektseminar steht in engem Zusammenhang mit dem Seminar „Fluchtpunkt USA“ und soll zu eigenständigem Umgang mit Quellen- und Archivmaterial am Beispiel Exil und Emigration nach Amerika anleiten. Neben biografischen Studien zu noch nicht oder wenig beforschten Einzelpersonen, zu Briefwechseln und literarischen Texten sollen auch Zeitschriften wie der Aufbau im Hinblick daraufhin untersucht werden, wie hier im einzelnen Begriffe wie Emigration und Exil sowie kulturelle Identität, Interkulturalität und Mehrsprachigkeit verhandelt werden. Grundlage sind dabei vor allem die Bestände des zur Hamburger Exil-Forschungsstelle gehörenden Paul-Walter-Jacob-Archivs, aber auch die des Exil-Archivs der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt, zu dem eine Exkursion unternommen werden soll. Begleitet wird diese Archivarbeit durch Bibliothekare, die konkrete Anleitungen und allgemeine Einblicke in unterschiedliche Archivierungskonzepte geben.
Neben der eigentlichen Archivarbeit, bei der in Gruppen kleinere Präsentationen erarbeitet werden sollen, stellt das Seminar theoretische Texte zum Archiv (z.B. von J. Derrida, A. Assmann, U. Wirth, C. Vismann) vor und stellt das archivalische Tun in einen größeren Kontext kulturwissenschaftlicher Reflexion von Erinnerung, kulturellem Gedächtnis und Speichermedien.
Doerte Bischoff, Miriam N. Reinhard: „Jerusalem in der Literatur“ (Seminar II)
Die literarische Rede über Städte hat immer auch Teil an kulturellen Imaginationen und Mythisierungen, die sie affirmiert und/oder unterläuft. An kaum einem Beispiel lässt sich dies eindrücklicher zeigen als an der Literatur, deren Schauplatz und/oder Fluchtpunkt Jerusalem ist. Vor allem in der jüdischen Tradition gilt Jerusalem (Zion) als paradigmatischer Ort des Ursprungs und der Sehnsucht in Zeiten des Exils und der Diaspora; im Wunsch „nächstes Jahr in Jerusalem“, der das jüdische Passah-Mahl abschließt, verknüpfen sich - je nach Akzent und Auslegung - messianische und zionistische Bedeutungen mit dem Namen der Stadt. Alle drei monotheistischen Religionen entwerfen Jerusalem als heiligen Ort. Dabei wird die Diskrepanz zwischen der geografischen Gegebenheit und dem Erlösungsversprechen, dem irdischen und dem himmlischen Jerusalem immer wieder zum Ausgangspunkt hermeneutischer, rhetorischer und ästhetischer Erkundungen. In der bis ins christliche Mittelalter für die Deutung der Bibel gängigen Lehre vom vierfachen Schriftsinn ist Jerusalem das Standardbeispiel für eine vielfältige, nämlich vierfache Schrift-Auslegung, in der wörtliche und übertragene Bedeutungen sich überlagern. Bis heute ist Jerusalem ein Ort, an dem unterschiedliche (religiöse, politische, kulturelle) Ansprüche und Deutungen konflikthaft aufeinandertreffen, wobei gerade die Literatur Verhandlungsraum für historisch je unterschiedliche Weisen des Umgangs mit Mehrfachkodierungen und Territorialismen gewesen ist.
Im Fokus des Seminars stehen Texte zumeist jüdischer AutorInnen, die das Spannungsfeld zwischen religiöser und kultureller Verortung und deren Entzug durch Vieldeutigkeit, Bedeutungsverschiebung und Sprachkritik auf unterschiedliche Weise ausloten. Gelesen und diskutiert werden sollen neben Gedichten (u.a. von Jehuda Amichai, Else Lasker-Schüler, Nelly Sachs) z.B. Lessing Nathan der Weise, Moses Mendelssohn Jerusalem, Heine Jehuda ben Halevy und Der Rabbi von Bacherach, Leopold Kompert Die Kinder des Randars, Theodor Herzl Altneuland, Stefan Zweig Jeremias, Else Lasker-Schüler Hebräerland, Lena Gorelik Hochzeit in Jerusalem, David Grossmann Wohin du mich führst, Peter Stephan Jungk Rundgang, Anna Mitgutsch Abschied von Jerusalem.
Sommersemester 2011
Doerte Bischoff: „Exil - Literatur - Judentum. Literarische und theoretische Erkundungen“ (Seminar II)
Sämtliche jüdische Autorinnen und Autoren, die vor 1933 in Deutschland oder Österreich geschrieben und publiziert hatten, wurden während der nationalsozialistische Diktatur, sofern ihnen überhaupt noch die Flucht gelang, ins Exil getrieben. Dieses Schicksal teilten sie mit anderen, die aus politischen Gründen verfolgt wurden oder als Protest gegen die faschistische Barbarei außer Landes flohen. Ist es wegen dieser Parallelen und wegen der Vielstimmigkeit jüdischer Reaktionen auf das Exil überhaupt sinnvoll, diese Gruppe gesondert zu betrachten? Dafür spricht, dass sich manche AutorInnen, die vor 1933 als assimilierte deutsche oder österreichische Staatsbürger ohne Bezug zur jüdischen Tradition gelebt hatten, im Exil wieder stärker diesen Überlieferungen zuwandten. So spielt die Auseinandersetzung mit Hiob oder Ahasver, beides Figurationen einer langen Geschichte jüdischen Leids und antisemitischer Ausgrenzung in vielen Texten eine wichtige Rolle. Die Rückbesinnung auf eine jüdische Schicksalsgemeinschaft wird dabei allerdings häufig auch durch eine Affirmation transnationaler Existenzweisen begleitet, die im Bezug auf jüdische Exil-Konzepte (Diaspora, Galut) Identitäts- und Gemeinschaftsentwürfe präfigurieren, wie sie in aktuellen Debatten und Literaturen vielfältig, gerade auch von jüdischen AutorInnen erprobt werden. Untersucht und diskutiert werden soll, inwiefern im Bezug auf jüdische Exilerfahrungen und -traditionen Heimatkonzepte, die sich mit ausschließenden nationalen Identifizierungen verschränken, problematisch werden und der Blick für alternative Formen hybrider und transkultureller Identität, die für das Zeitalter von Globalisierung und Massen-Migrationen prägend sind, geöffnet wird.
Neben der Analyse literarischer Texte von den 30er Jahren bis zur Gegenwart (z.B. Lyrik von Karl Wolfskehl, Rose Ausländer, Yvan Goll, Mascha Kaleko; Erzähltexte (bzw. Auszüge) von Else Lasker-Schüler, Robert Neumann, Joseph Roth, Anna Seghers, Hans Sahl, W.G. Sebald, Barbara Honigmann, Doron Rabinovici oder Vladimir Vertlib) stehen im Seminar essayistische und theoretische Auseinandersetzungen mit dem Spannungsverhältnis von Heimat und Exil in jüdischer Tradition im Zentrum (z.B. von Margarete Susman, Franz Rosenzweig, Hannah Arendt, Maurice Blanchot, Vilem Flusser).
Doerte Bischoff: „Pass-Geschichten. Deutschsprachige Exil- und Gegenwartsliteratur“ (Seminar II)
„Was ist ein Mensch ohne Papiere? Nackter als ein Neugeborener, nein, nackter als ein Skelett unter der Erde!“ - Dies erfährt die Hauptfigur in Franz Werfels Exildrama Jacobowsky und der Oberst am eigenen Leibe, als nämlich ein wahnsinnig gewordener Konsul seinen Pass mit allen mühsam erworbenen Transitvisen ins Feuer wirft und ruft „Heil Hitler! Ich heize mit Menschen!“ Das prekäre Verhältnis von Pass, Identität und (Über-)Leben spielt in vielen Texten über das Exil aus Nazi-Deutschland einen zentrale Rolle. In Brechts Flüchtlingsgesprächen wird der Pass ironisch als „edelster Teil des Menschen“ beschrieben, der selbst lediglich als Anlass und mechanischer Halter des Passes fungiert. In Anna Seghers' Transit nehmen die Beschreibungen der Konsulatsbesuche und der Abhängigkeit der Emigranten von ebenso unerbittlichen wie willkürlichen bürokratischen Akten kafkaeske Züge an. Ziel des Seminars ist es, diese literarischen Befunde zu kontextualisieren, indem das Passwesen als Symptom staatlicher Identifizierung- und Bürokratisierungs-Strategien reflektiert wird, die mit der Ausbildung der modernen Nationalstaaten in einem engen Zusammenhang stehen. Deren Grenzen und Probleme treten nicht nur während der NS-Zeit, in der infolge ausschließender Staatsbürgerschaftsgesetze etwa 40.000 Menschen staatenlos wurden, zutage, sie sind auch in den brisanten Diskussionen um staatenlose Flüchtlinge, um mehrfache Staatsbürgerschaft oder um biometrische Pässe von großer Aktualität.
In der Diskussion neuerer literarischer Texte etwa von Mario Szenessy, W.G. Sebald, Herta Müller, Vladimir Kaminer, Feridun Zaimoğlu oder Terézia Mora sollen thematische und strukturelle Korrespondenzen zu den klassischen Exiltexten aufgesucht werden. Zur historischen Kontextualisierung und methodischen Reflexion der Textanalysen sollen außerdem kulturgeschichtliche und -theoretische Studien zur Entwicklung des Passwesens, zur Wechselwirkung von Menschen und Dingen (Akteur-Netzwerk-Theorie) und zu Formen der Überwachung (surveillance studies), die gemeinsame erarbeitet werden, beitragen.
Wintersemester 2009/2010
Doerte Bischoff: „Transit – Exilliteratur und Transkulturalität“ (Seminar II)
Durch den massenhaften Exodus von SchriftstellerInnen und Intellektuellen aus den von den Nazis beherrschten Gebieten, ihre Flucht in nahezu alle Länder der Welt, wurde das Leben und Schreiben im Exil zu einem Phänomen, das nicht nur einzelne betraf, sondern für eine ganze Generation von Kulturschaffenden typisch und prägend war. In mancher Hinsicht stellt die totalitäre Usurpation und Korruption des Nationalstaates als Heimat und Bezugsgröße (auch) der Kultur durch den Nationalsozialismus ein Erbe dar, mit dem sich jede Literatur seither auseinandersetzen muss. Tatsächlich lässt sich beobachten, dass gerade neuere „Literaturen ohne festen Wohnsitz“ (Ottmar Ette), die sich nicht in Bezug auf ein einziges Herkunfts-Land, manchmal nicht einmal in Bezug auf eine Sprache, sondern zwischen den Welten und Herkünften entwerfen, dieses Erbe antreten, indem sie Denkfiguren und Sprachbilder dieser Exilliteratur aufgreifen und weiterführen.
So verschränkt etwa die Figur des Transits Exiltexte aus den 1940er Jahren mit Dokumenten transkulturellen Schreibens zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Das Seminar will diesen Bezügen nachgehen, indem es das Augenmerk besonders auf Problematisierungen von Heimat und Herkunft, kultureller Identität und Autorschaft richtet, die Konstellationen der Exterritorialität und Bewegungen zwischen den Räumen und Orientierungen hervor treten lassen. Ein Fokus liegt dabei auf Texten jüdischer AutorInnen, die nicht nur in besonderer Weise eine Erfahrung existentiellen (d.h. nicht auf politische Kategorien rückführbaren) Verworfenseins reflektieren, sondern die zugleich immer wieder auch an jüdische Traditionen des Exils (Diaspora, Galut) anschließen. Indem sie nicht nur Versuchen, dem nationalsozialistischen ein anderes Deutschland entgegen zu setzen, sondern auch einer zionistischen Antwort auf Antisemitismus und Verfolgung eine Absage erteilen, lassen sie sich vielfach als Schnittstellen zwischen Exilliteratur im engeren (historischen) Sinne und einem weiter gefassten literatur- und kulturwissenschaftlichen Exilbegriff auffassen.
Neben Texten von Alfred Döblin (Babylonische Wanderung); Else Lasker-Schüler (Der Wunderrabiner von Barcelona; Das Hebräerland) Anna Seghers (Transit, Der Ausflug der toten Mädchen), Franz Werfel (Jacobowsky und der Oberst); Yvan Goll (Johann Ohneland); Peter Weiss (Der Schatten des Körpers des Kutschers) und Wolfgang Hildesheimer (Zeiten in Cornwall) stehen programmatische und theoretische Reflexionen zur Poetik des Exils (J. Amery, I. Kertecz, M. Blanchot, E. Bronfen, Sh. Trigano u.a.) zur Diskussion.

